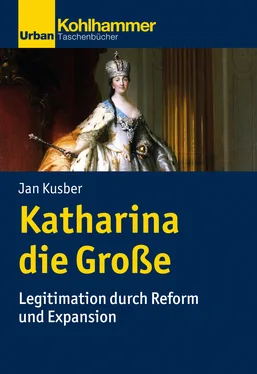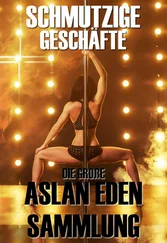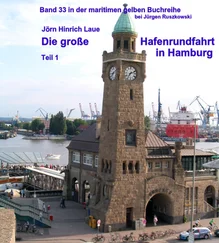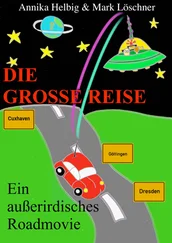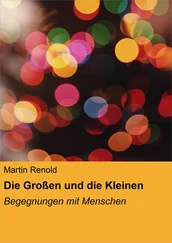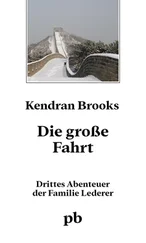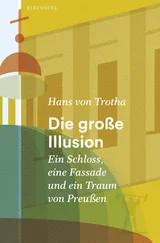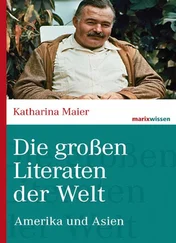Die Selbstwahrnehmung Friedrichs II. war die eines Königs, der eine aufsteigende Großmacht im Krieg um Schlesien gegen Österreich in Stellung brachte. Der Feldherr überlagerte in dieser Zeit die Selbstinszenierung als aufgeklärter Monarch. Die Kaiserin Elisabeth verachtete er, auch wenn ihm ihre Neutralität im ersten und zweiten Krieg um Schlesien (1740–1742, 1744–1745) wichtig war. 31Ebenso bedeutend war für ihn eine Abstimmung mit dem Zarenreich über eine gemeinsame Politik gegenüber der polnisch-litauischen Adelsrepublik. Während die russischen Herrscher seit dem Großen Nordischen Krieg (1700–1721) und insbesondere seit dem stummen Reichstag von Grodno das Ziel hatten, die gesamte Adelsrepublik als Protektorat zu lenken und ihnen dies auch weitgehend gelang, etwa im russisch-polnischen Thronfolgefolgekrieg (1733–1736) 32zur Zeit der Kaiserin Anna, bezogen sich die preußischen Ambitionen, wie sie in den Hohenzollerntestamenten niedergelegt wurden, 33vor allem auf Danzig, Thorn und Westpreußen. Sophie und ihre Mutter ›umfuhren‹ dieses Feld außenpolitischer Aspirationen, da sie den Seeweg von Lübeck über Reval nahmen, durchschifften aber gleichsam ein weiteres Politikfeld – die Ostsee.
Die Auseinandersetzung um das dominum maris baltici war im Großen Nordischen Krieg mit Schwedens Verlust seiner baltischen Provinzen an Russland 1721 nur teilweise entschieden worden. 1741 beschloss die im schwedischen Reichstag dominierende Adelsgruppierung der sogenannten Hüte, den Versuch zu unternehmen, die Ergebnisse des Friedens von Nystadt zu revidieren, und Russland den Krieg zu erklären. Auf diesen Krieg war mit Hilfe der französischen Außenpolitik länger hingearbeitet worden, und man hatte gehofft, das Zarenreich in einen Zweifrontenkrieg zu verwickeln. Seit 1735 befand sich St. Petersburg im Krieg gegen das Osmanische Reich. Doch 1739 hatten Russen und Osmanen in Belgrad bereits Frieden geschlossen. Von dem Staatsstreich Elisabeths, der von Frankreich unterstützt worden war, erhoffte sich die schwedische Kriegspartei einen schnellen Friedensschluss, doch sie hatte sich getäuscht. Elisabeth befahl ihrem General Peter Lacy die Gegenoffensive an den Küsten des finnischen Meerbusens, und die Region um Helsinki konnte eingenommen werden. Der Frieden von Åbo 1743 brachte leichte Gebietsgewinne für Russland und es konnte durchgesetzt werden, dass mit Adolf Friedrich, Onkel des für Russland ausersehenen Neffen Elisabeths, ein Gottorfer als schwedischer Thronfolger benannt wurde. 34Als Sophie 1744 russischen Boden betrat, hatte Elisabeth also ihre ersten Feuerproben in der Außenpolitik bestanden und sich als unabhängig von französischen Interessen, die ihr Subsidien gebracht hatten, gezeigt.
Dieses Russische Imperium in den ersten Jahrzehnten nach den Reformen und Kriegen Peters des Großen, in das Sophie 1744 gereist war, war eines des Wandels und der Beharrung zugleich. Dem Transfer und der ›Verwestlichung‹ der Eliten – die sich übrigens in einer erstaunlichen Geschwindigkeit vollzog – stand eine Beharrungskraft der traditionalen Gesellschaftssegmente gegenüber, insbesondere außerhalb der Metropolen. Die Entfaltung einer glanzvollen Hofkultur und die Verfestigung der Sozialstruktur einer Dienstgesellschaft begünstigten einander. Das Imperium war als kontinentale Flügelmacht nach der Eroberung des Ostseezugangs in der Zeit Peters I. als Akteur in Europa eine feste Größe, auch wenn der Anspruch der Autokratinnen auf Gleichrangigkeit in Europa insbesondere bei den Habsburgern auf Widerstand stieß. 35Die Gattin eines Großfürsten zu werden, der der Kaiserin Elisabeth nachfolgen sollte, war eine Chance, deren Tragweite Sophies Familie sicher deutlich vor Augen stand. Ob sich die kaum 15-jährige Zerbster Prinzessin auf ihrer Reise dessen klar bewusst war, wie Katharina später in ihren Memoiren behaupten sollte, wissen wir nicht.
Katharinas Weg nach Russland und ihre Großfürstinnenzeit
Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg wurde am 2. Mai 1729 im pommerschen Stettin geboren. Ihr Vater, Christian August, Fürst von Anhalt-Zerbst, gehörte zur regierenden Anhaltinischen Familie, die jedoch nicht in der Lage war, ihre männlichen und weiblichen Mitglieder standesgemäß zu ernähren. Damit stand Christian August, der immerhin aus dem traditionsreichen Geschlecht der Askanier stammte, keineswegs allein. Viele Mitglieder der Fürstenhäuser des Heiligen Römischen Reiches waren entweder, wenn männlich, auf den Dienst an bedeutenderen Höfen und Staaten oder, wenn weiblich, auf eine ökonomisch auskömmliche Heirat angewiesen. So ging es auch Christian August, der einen Generalsrang in preußischen Diensten bekleidete, zum Zeitpunkt der Geburt seiner Tochter jedoch als Gouverneur von Stettin amtierte. Stettin war am Ende des Großen Nordischen Krieges 1720 in preußischen Besitz gekommen. Die Preußen siedelten wichtige Verwaltungseinrichtungen an und bauten Stettin weiter zu einer Festungsstadt aus. Das Altpreußische Infanterieregiment Nr. 7 wurde nach Stettin verlegt, und Stettin wurde so zur preußischen Garnisonsstadt. Es war also kein höfisches Umfeld, in dem Sophie ihre ersten Jahre verbrachte. 1Christian August war, im Gegensatz wohl zu seiner Frau, ein tiefgläubiger Lutheraner.
Sophies Mutter, Johanna Elisabeth von Gottorf, entstammte einer Dynastie, die in der Politik der Mächte eine Rolle spielte. Peter der Große hatte eine seiner Töchter mit einem Gottorfer Herzog verheiratet. Wegen der Besetzung des Stammschlosses in Schleswig durch Dänemark hatte die Tochter in Kiel residiert und dort wurde Karl Peter Ulrich am 21. Februar 1728 geboren, ein Cousin zweiten Grades der jungen Sophie. Die Familie Johanna Elisabeths stand also in einem ganz anderen Maße im Fokus (nord)europäischer Politik als die Askanier, die im kleinen Zerbst regierten. Und Johanna Elisabeth hatte ganz offensichtlich ein hohes Bewusstsein ihrer eigenen Bedeutung und der ihrer Nachkommen. 2Für Sophie, Prinzessin und Tochter eines preußischen Generals, war eine gute Heirat eine echte Zukunftschance. Über die Kindheit der späteren Kaiserin Katharina ist nicht allzu viel bekannt, wobei ihre Bemerkung gegenüber ihrem Korrespondenten Baron Friedrich Melchior Grimm, 3sie habe nichts von Interesse aus ihrer Kindheit zu berichten, vor dem Hintergrund der Position, die sie nach der Thronbesteigung 1762 innehatte, sicher als Koketterie einzuordnen ist.
Wir besitzen über ihre Kindheit, Jugend und ihre Zeit als Großfürstin nach 1744 vor allem eine zentrale Quelle – die Memoiren, an denen sie schon als Großfürstin, aber auch als Kaiserin vor allem bis etwa 1772, danach nur sporadisch, arbeitete. Von den verschiedenen kurzen und langen Versionen sind fünf französische und zwei russische Textstücke bekannt, die erst 1859 erstmals und nur in Teilen erschienen, nach einer nicht ganz zuverlässigen Abschrift herausgegeben von Alexander Herzen in London. Die Memoiren haben Generationen von Historikerinnen und Historikern fasziniert, weil sie eine Sogkraft entwickeln, der man sich bis heute kaum entziehen kann. 4Insbesondere für die Kindheit sind sie zudem die einzig verwertbare Quelle. Blickt man auf die Stationen ihrer jungen Jahre – die Jahre in der Garnisonsstadt Stettin und in der den Zerbstern gehörenden Herrschaft Jever, 5die wiederholten Aufenthalte in Berlin und den kurzen Aufenthalt in Eutin 1739, wo sie ihren späteren Ehemann, Karl Peter Ulrich, kennenlernte –, so sind weder in der Erziehung her noch über die Nähe oder besser Distanz zu den Eltern außergewöhnliche Vorkommnisse festzuhalten. Dies wollte zumindest Katharina selbst später so gesehen wissen. Als ihr gelehrter Briefpartner, Baron Friedrich Melchior Grimm, 1776 den Wunsch äußerte, nach Stettin zu reisen, antwortete sie ironisch: »In all diesem sehe ich durchaus nichts interessantes, es sei denn, Sie glaubten, die Örtlichkeit sei von Bedeutung und habe Einfluss auf die Geburt passabler Kaiserinnen.« 6Ob und inwieweit die Frömmigkeit und das Pflichtbewusstsein des Vaters oder die Ambitionen der Mutter auf sie gewirkt haben, erfahren wir aus den Memoiren so, wie Katharina es überliefert wissen wollte. Bei Rückschlüssen, Orte, Menschen und Ereignisse hätten sie und ihr späteres Regierungshandeln in dieser oder jener Weise geprägt, ist schon aufgrund der relativen Quellenarmut Vorsicht geboten. 7
Читать дальше