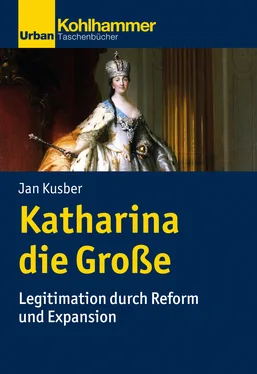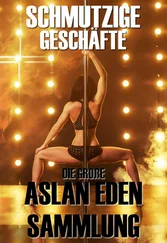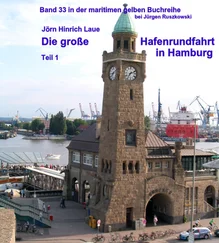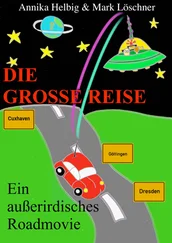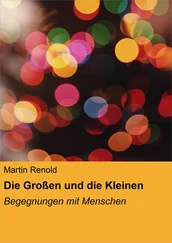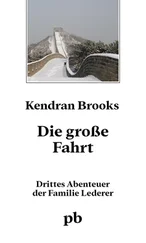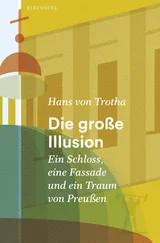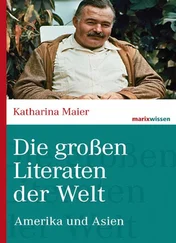Als sie 1796 starb, schrieb ein Zeitgenosse vielsagend, dass Katharina ›der Große‹ gestorben sei. 8Er zollte damit einer Regierung Tribut, deren Mittel und Strategien all jene Elemente aufwiesen, die Erfolg versprachen – und jene waren männlich konnotiert. Zugleich setzte mit dem Tod Katharinas ein Nachleben ein, das die öffentliche Wahrnehmung bis heute prägt und in dem Sensationslust und Kolportage die Frage nach ihrem politischen Handeln im klassischen Sinne oft in den Hintergrund treten ließen. Ihre Affären, ihre Favoriten, die in der europäischen Öffentlichkeit diskutierte Libertinage bei Hofe 9und nicht zuletzt die Ermordung ihres Gatten Peter haben Generationen immer wieder neu fasziniert, sodass diese Elemente der Biografie nicht selten aus dem politischen Kontext gelöst wurden. 10Durch ihre freie, unkonventionelle Lebensweise hat Katharina als Person immer fasziniert. Auch diese Elemente hatten in jedem Falle eine politische Qualität und interessieren in dieser Sicht, wenngleich sie nicht im Zentrum stehen, auch im vorliegenden Buch. 11
Gegenstand dieses Buches ist die politische Dimension ihres Lebens – ihre Reformen und die von ihr vorangetriebene Expansion des Russischen Imperiums an sich, aber auch deren Inszenierung zur Erlangung von Geltung und Prestige. Zugleich geht es um die Diskussion der von ihr selbst aufgestellten Maxime, dass man den Herrscher an das Recht binden müsse – in einer dem Reich angemessenen Weise. 12Ein solcher Anspruch als Leitmaxime ist seit den Thronfolgemanifesten, mit denen sie ihre Thronbesteigung und den Sturz Peters III. begründete, ihre Legitimationsstrategie gewesen.
Wie gut kannte sie ›ihr‹ Reich und seine multireligiöse und multiethnische Untertanenschaft? Auch das Imperium als Herausforderung und Kategorie für herrscherliches Handeln wird darzustellen und in die Erörterung miteinzubeziehen sein. 13Eine allumfassende Biografie Katharinas II. ist nicht angestrebt und wohl auf absehbare Zeit unmöglich. Noch immer schlummern ungesehene Handschriften Katharinas in den Archiven und zugleich ist eine Unzahl von Publikationen über sie erschienen. Während sie in der Sowjetunion kaum im Zentrum des Interesses historischer Forschung stand und stehen durfte, hat man sich ihr in postsowjetischer Zeit intensiv und vor allem mit Blick auf die Hofgeschichte zugewandt. Dies bedient das Interesse an Personengeschichte einerseits, anderseits das Interesse an einer Erzählung der russischen Geschichte, die das Imperium im territorialen und im Sinne der Geltung ›groß‹ macht. 14
In jedem Fall steht dieses Buch auf den Schultern von Riesen. Nach wie vor ist Isabel de Madariagas Russia in the Age of Catherine the Great 15in der Verbindung von biografischem Ansatz und Zeitpanorama unübertroffen. Dies gilt sowohl für die Detailliertheit der Darstellung als auch für den umfassenden Zugriff. Andere Autoren wie John T. Alexander und Simon Dixon betonten eher die Herrscherin in ihren persönlichen Beziehungen und ihrer höfischen Umwelt – Themen, die auch im postsowjetischen Umfeld neue Konjunkturen erlebten und erleben. 16Jüngst fügte Francine-Dominique Liechtenhan durch die Nutzung päpstlicher Archive neue Sichtweisen hinzu. 17
Feststeht, dass jede Generation von Katharina II. und ihrer Herrschaft neu fasziniert ist, sie aber anders liest und deutet. 18Kategorien historischer Größe verändern sich; das Russische Imperium wird gerade am Beginn des 21. Jahrhunderts neu konzeptualisiert und natürlich auch immer aus der jeweiligen Gegenwart heraus verstanden. Ich folge hier einem Ansatz, der die Kulturgeschichte des Politischen mit einer Gesellschaftsgeschichte Russlands zusammenbringt und dabei die Perspektive der Herrscherin in den Mittelpunkt stellt. Diese speiste sich im Falle Katharinas aus einem sich über Jahrzehnte hinweg entwickelnden Koordinatensystem, das sich schon in ihrer Großfürstenzeit ausprägte und erst recht in ihrer Regierung fortentwickelte.
Es ging ihr um Legitimation und Legitimität durch gute Herrschaft. Diese wurden befördert durch das öffentlichkeitswirksame Reden und Handeln. Hinzu traten das Implementieren und die Umsetzung von Reformen einer Herrscherin, die bereit war, oder es doch zumindest so postulierte, sich selbst an das Recht zu binden. Und es ging bei ihrem Handeln in den Kategorien des internationalen Prestiges auch um Geltung durch Expansion.
Katharina II. war nicht die erste Kaiserin von Russland. Peter I. hatte seine Frau Katharina I. nicht nur zur Kaiserin krönen lassen und selbst 1722 den Imperatortitel angenommen, um die von ihm beanspruchte Bedeutung zu unterstreichen; seine Frau folgte ihm in Amt und Titel nach. 19Kaiserin Anna, Peters Nichte, regierte Russland zehn Jahre, Elisabeth, Peters Tochter, regierte Russland 20 Jahre. 20Weibliche Herrschaft war also ein der Untertanenschaft des Imperiums wie den europäischen Mächten vertrautes Phänomen und wurde weder in Russland noch an den europäischen Höfen in Zweifel gezogen. Auch der legitimatorische Bezug auf Peter I., den Katharina immer wieder suchte, war insbesondere von Elisabeth ubiquitär genutzt worden.
Was Katharina von ihren Vorgängerinnen unterschied, war ihr enormes Arbeitspensum, ihr Interesse auch am Funktionieren von Staat und Gesellschaft insgesamt, ihre Liebe zum Detail und nicht zuletzt ihre Bildung und ihr Intellekt. Letztere bildete sie erst in Russland aus und zwar in jenen langen Jahren als Großfürstin an der Seite ihres Mannes, des Großfürsten Peter, der als Gottorfer Herzog Karl Peter Ulrich landfremd war wie sie selbst. Russland, seine Gesellschaft, die Hauptstadt, der Hof und die mit ihnen verbundenen Lebenswelten waren ihnen beiden unbekannt. Beide aber befassten sich auf ganz unterschiedliche Weise mit jenem Land, in dem sie den Rest ihres Lebens verbringen sollten.
Russland um die Mitte des 18. Jahrhunderts
Im Januar 1744 reiste Sophie Friederike, die spätere Katharina II., nach Russland, wohin sie Kaiserin Elisabeth, die Tochter Peters des Großen eingeladen hatte, 1um den ausersehenen Thronfolger Karl Peter Ulrich, ihren Neffen, zu heiraten. Diese Reise von Zerbst nach Russland führte sie über Berlin, wo sie Friedrich II. traf, nach Reval (Tallinn), und von St. Petersburg nach Moskau, wo sie im Februar 1744 eintraf. Ihre ersten Eindrücke von Russland hatte die Zerbster Prinzessin also reisend erfahren: Sie lernte das Baltikum kennen, St. Petersburg, die wachsende Kapitale Peters I. an der Neva, den beschwerlichen Weg nach Moskau, der sich freilich im tiefen Winter mit dem Schlitten vergleichsweise komfortabel und schnell zurücklegen ließ. Alles war um vieles größer und weiträumiger als das, was sie kannte – Stettin, Zerbst, Berlin. Der Raum, so reflektierte Katharina als Großfürstin, aber auch als Herrscherin immer wieder, war für jede Regierung des Russischen Imperiums eine Herausforderung ersten Ranges.
Dieses Reich erstreckte sich um die Mitte des 18. Jahrhunderts von der Ostsee bis an den Pazifik. Peter I. hatte Livland, Estland und Ingermanland im Großen Nordischen Krieg (1700–1721) von Schweden gewonnen. St. Petersburg, 1703 gegründet, hatte dem bis dahin führenden Hafen am Weißen Meer, Archangel’sk, schon in den ersten Jahren seiner Existenz den Rang abgelaufen. Im Osten des Reiches war die Eroberung Sibiriens bereits im 17. Jahrhundert erfolgt: 1639 erreichte man bereits das Ochotskische Meer, 1689 und 1727 wurden mit den Verträgen von Nerčinsk bzw. Kjachta erste Verträge mit der Ching-Dynastie Chinas geschlossen. Scharfgezogene Grenzen zum Mandschureich bedeutete dies freilich nicht. 2Sibirien und der Ferne Osten waren extrem dünn besiedelt. In Westsibirien etwa gab es breite Übergangszonen zu Ethnien, die nomadisch lebten, Kasachen, Kirgisen und andere. Auch im Süden des europäischen Russlands existierten keine festen Grenzen. Während man an den Mündungen von Wolga und Don mit Astrachan und Azov Festungen hatte, war das ›wilde Feld‹ (dikoe pole) zu den Krimtataren und mit dem autonomen Kosakenhetmanat der sogenannten linksufrigen Ukraine von einer ebensolchen breiten Übergangszone geprägt. 3
Читать дальше