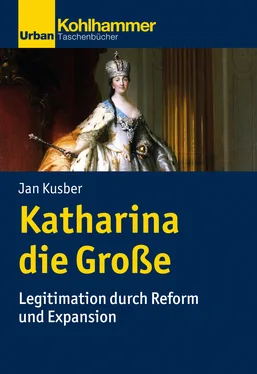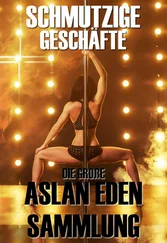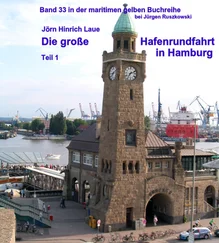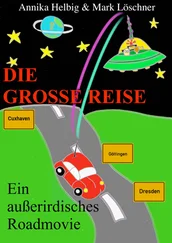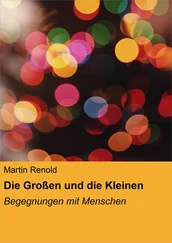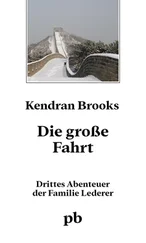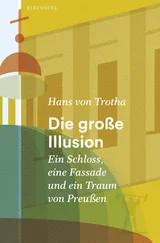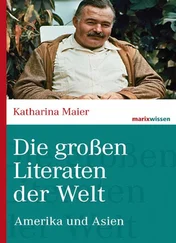Dieses Reich war das größte Flächenland der Welt, und seine Herrscherinnen und Herrscher kannten es nur wenig: Die bedeutenden Expeditionen nach Sibirien, die noch Peter der Große veranlasste, dienten etwa dazu, Kenntnis über das Reich, seine Menschen und seine naturräumliche Gestalt zu erhalten. Zwischen 1720 und 1727 bereiste der deutsche Mediziner Daniel Gottlieb Messerschmidt (1685–1735) West- und Zentralsibirien. Die Erste und Zweite Kamčatkaexpedition (1728–1730 bzw. 1733–1743) waren Forschungs- und Entdeckungsreisen unter der Leitung des Marineoffiziers Vitus Bering, deren Teilnehmer Sibirien erforschten, die nördlichen Küsten des Russischen Reiches vermaßen und Seewege vom ostsibirischen Ochotsk nach Nordamerika und Japan erkundeten. 4Die Informationen, die auf diesen und anderen Expeditionen über die Zahl und Lebensweise der Völker gewonnen wurden, führten zu etwas genaueren Vorstellungen, wie dieses Reich sich zusammensetzte, funktionierte und wie es zu entwickeln sei.
Russland war ein multiethnisches und multireligiöses Imperium. Nach in ihrer Zuverlässigkeit umstrittenen Schätzungen lebten 1719 etwa 16 Millionen Menschen, um 1750 aber schon etwa 25 Millionen und am Ende der Herrschaft knapp 38 Millionen Menschen im Russischen Reich: 5Viel als absolute Summe, wenig mit Blick auf die Fläche. In Teilen war Russland eine monarchia mixta, ein Herrschaftsgebiet mit durchaus unterschiedlichen Rechtsverhältnissen und jeweils verschieden verfassten Untertanenschaften. Der gemeinsame Bezug war die Autokratie, die das bindende Element darstellte. 6Davon konnte sich die nach Moskau reisende Sophie Friederike einen ersten Eindruck verschaffen. In Reval stieß sie auf eine Stadt mit einer ganz anderen Tradition und Stadtverfassung als in St. Petersburg oder in russischen Provinzstädten. Während die Selbstverwaltung der Städte des Baltikums auf den Traditionen mittelalterlicher Stadt- und Handelsrechte beruhte, kannten Städte seit den Städtereformen Peters I. am Beginn des 18. Jahrhundert zwar Begrifflichkeiten wie Magistrate oder Bürgermeister. Doch Selbstverwaltung und Autonomie kannten sie kaum. 7
Die ersten Adligen, denen die Zerbster Prinzessin begegnete, stammten aus den Ritterschaften des Baltikums. 8Sie gehörten zu jenen Adelsgruppen, die ihre fortgeschriebenen Privilegien, was ständische Rechte und Schutz des Protestantismus anging, zu behaupten suchten. Sie waren nicht die einzigen Gruppen mit Sonderrechten. Die Kosakenverbände, etwa das erwähnte Hetmanat, aber auch am Don und am Jaik, genossen Autonomie.
Von St. Petersburg nach Moskau 9aber reiste Sophie durch von Russen besiedelte Gebiete und hier mochte sie einen ersten Eindruck von der Orthodoxie als Bestandteil der russischen Lebenswelt bekommen haben. Die russische Bevölkerungsmehrheit des Imperiums war orthodox, ihre Kirche vielleicht die einzige Institution, die den Staat in der Fläche repräsentierte. An den Peripherien des Reiches lebten aber auch Millionen von Untertanen, die sich nach der Kirchenspaltung (raskol) um die Mitte des 17. Jahrhunderts den sogenannten Altgläubigen zurechneten. Im Wolga-Kama-Raum lebten muslimische Ethnien, die nach der Eroberung Kazans 1552 durch Ivan IV. Groznyj unter die Herrschaft der Zaren geraten waren – muslimische nomadische Baschkiren sahen sich orthodoxen Kolonisten gegenüber. 10In Sibirien und im hohen Norden existierte zumindest bis weit ins 18. Jahrhundert hinein nicht nur der Doppelglaube (dvoverie), das Nebeneinander von naturreligiösen und orthodoxen Traditionen, sondern lebten Jakuten und Kamčadalen pagan. 11Unter Kalmücken und Tuwinern war der Buddhismus verbreitet. Mission durch die orthodoxe Kirche konnte also aus der Sicht des Staats ein Vorantreiben von Territorialisierung bedeuten, stieß aber, als sie etwa in der Zeit der Kaiserin Elisabeth im Wolga-Kama-Raum intensiver betrieben wurde, auf Widerstand. 12In der Regel dominierte ein pragmatischer Umgang mit religiöser und ethnischer Differenz. Eine Ausnahme sei genannt: In Russland gab es keine nennenswerte jüdische Bevölkerung, sondern es existierte ein verbreiteter Antijudaismus. Kaiserin Elisabeth selbst war ein Beispiel dafür. 13
Sophie reiste in ein agrarisch geprägtes Reich, darin unterschied sich Russland nicht von anderen frühneuzeitlichen Herrschaftsbildungen. Eine Besonderheit war jedoch der geringe Urbanisierungsgrad. Die neue Hauptstadt St. Petersburg besaß etwa 150.000 Einwohner, die alte Hauptstadt Moskau um die 200.000 Einwohner, aber die weit auseinanderliegenden Provinzstädte, oft aus mittelalterlichen burgstädtischen Siedlungen hervorgegangen, nur wenige Tausend. Sieht man einmal von den markanten Kirchenbauten und den Kreml- und Klosteranlagen ab – und natürlich von St. Petersburg, für das bereits Peter I. befohlen hatte, es dürfe nur Stein als Baumaterial verwendet werden –, war es ein Reich der Holzbauweise. 14Die Städte und Dörfer waren aus Holz und damit aus einem Material, das die naturräumlichen Gegebenheiten hergaben und das sich dem Klima, den kalten langen Wintern, den heißen Sommern und der kurzen Übergangszeit in Herbst und Winter, der Zeit der Wegelosigkeit, in idealer Weise anpasste. Steine hingegen mussten über weite Entfernungen herantransportiert werden. So übernachteten Sophie und ihre Mutter auf dem Weg von St. Petersburg des Öfteren in Gasthäusern aus Holz; die Gaststuben mögen ihr verraucht und fensterlos vorgekommen sein, aber sie hielten auf diese Weise effektiv Hitze oder Kälte ab.
Die überragende Mehrheit der russischen Bauern (ca. 90 %) war von ihrem Grundherrn abhängig. Die Leibeigenschaft, strukturgebend für den gesamten ostelbischen Raum seit der frühen Neuzeit, erreichte im Russischen Reich ihre wohl bindendste Form. 15Ob der Grundherr ein Adliger, ein Kloster oder die Krone war, der Bauer war an das grundherrliche Land gebunden. Sophie mochte sich in Zerbst keine Gedanken darüber gemacht haben, ob es den Zerbster Bauern auch so ging. In der zu Zerbst gehörenden ostfriesischen Herrschaft Jever, die sie als junges Mädchen besucht hatte und wo sie sich wohl gefühlt hatte, 16waren die Bauern frei. Solche freien Bauern, die sogenannten Einhöfer (odnodvorcy) gab es auch im Russischen Reich, etwa im hohen Norden oder in Sibirien als naturräumlichen Ungunsträumen. Ihre Zahl war jedoch gering. Menschen flohen vor der Leibeigenschaft, etwa an die südliche Peripherie (u krania) in das sogenannte wilde Feld (dikoe pole) und schlossen sich dort mit anderen Kosaken zusammen. Oder sie versuchten vor der Indienstnahme auf Gebiete auszuweichen, in denen sie auf nomadisierende Ethnien trafen, etwa im Kaukasusvorland oder im bzw. östlich des Ural. Durch die Verleihung von Land an den Adel in peripheren Räumen rückte das Prinzip der Leibeigenschaft in Form der Kolonisation jedoch nach. 17
In Zentralrussland war der Bauer im Wesentlichen an die Scholle gebunden. Er leistete je nach Region und, aus Sicht des Grundherrn, ökonomischem Zweck Frondienste (barščina) oder Zins (obrok), oder gar beides. Nachdem sich diese Form der Leibeigenschaft seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert gebildet hatte, wurde sie im Gesetzbuch des Zaren Aleksej von 1649, das auch hundert Jahre später noch die Grundlage jeder Rechtsprechung darstellte, festgeschrieben. Dies bedeutete theoretisch zwar nicht, dass der Bauer ›seinem‹ Grundherren auch physisch gehörte, doch die Praxis sah anders aus. 18Bauern konnten Manufakturen als Arbeitskräfte ›zugeschrieben‹ werden und wurden faktisch samt ihren Familien gehandelt. Zeitungen in der Zeit Kaiserin Elisabeths offerierten solche unter Annoncen. 1713 erlaubte Peter I. den Grundherren ausdrücklich, die Bauern mit der Knute zu züchtigen, 1741 verloren sie ihre Rechts- und Geschäftsfähigkeit und wurden vom Untertaneneid ausgeschlossen. Immerhin ging es hierbei um mehr als 80 % der Bevölkerung. Die Bauern trugen also in mehrfacher Hinsicht das Reich ökonomisch. Sie finanzierten den Adel und trugen die Kopfsteuer sowie Naturalleistungen. 1722 machte Peter I. die Gutsbesitzer zur denjenigen, die die Steuer einzutreiben und die Ordnung auf den Gütern aufrechtzuhalten hatten. 19
Читать дальше