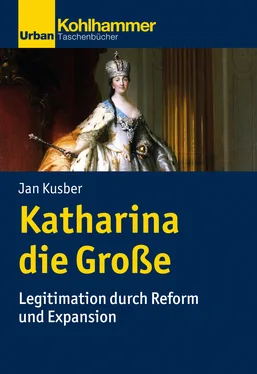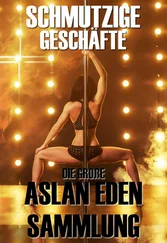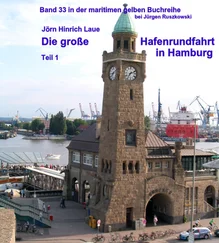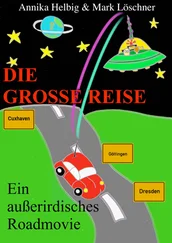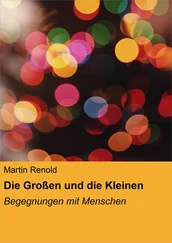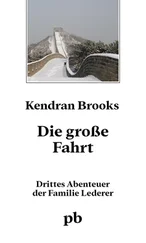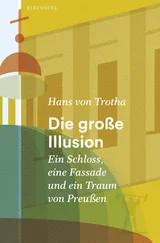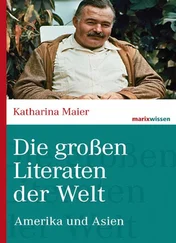Ähnlich wie in Preußen sollte sich eine Sonderbehörde um die Ansiedlung und Belange der Kolonisten kümmern. An die Spitze dieser bereits erwähnten, im Juli 1763 errichteten ›Vormundschaftskanzlei für Ausländer‹ stellte Katharina ihren damaligen Vertrauten Graf Grigorij Orlov. Die Verwaltung der Wolgakolonien wurde 1766 einer Unterbehörde, dem ›Vormundschaftskontor‹ (Opekunstvennaja Kontora) in Saratov übertragen. 1782 sollte diese Behörde im Zuge der Gouvernementsreform aufgelöst werden. 32Zu diesem Zeitpunkt existierten jedoch bereits trotz mancher nicht eingehaltener Zusage und Startschwierigkeiten – etwa Verwüstungen während des Pugačev-Aufstandes – bereits florierende Kolonien und damit Siedlungen, die die Deutschen in Moskau, St. Petersburg und andernorts ergänzten. 33
Freilich, die Kolonisten kamen nicht in ein leeres Land, wie auch in anderen frontier-Kontexten immer wieder behauptet wurde. Das Zusammenleben zwischen den verschiedenen Untertanengruppen erwies sich als ›imperiale Situation‹, die einerseits die Vielfalt des Reiches ausmachte, andererseits bei Katharina aber immer wieder den Wunsch nach Regulierung und guter Ordnung nährte.
Die Maßnahmen zeitigten nur langsam Erfolge. Um die erforderlichen Einwandererzahlen zu erreichen, beauftragte die russische Seite daher ab 1764 verstärkt private Agenten, Anwerber, die auf eigenes Risiko operierten und für jeden angeworbenen Kolonisten einen Festbetrag erhielten. Diese erhielten das Recht, mit potenziellen Interessenten individuelle Verträge zu schließen. Alles in allem warben sie fast die Hälfte aller bis 1774 nach Russland eingewanderten Personen an. Es zeigte sich, dass das Angebot der russischen Kaiserin vor allem in den deutschen Fürstentümern und freien Reichsstädten auf fruchtbaren Boden fiel: Nicht zuletzt die staatliche Zersplitterung und die schwache Zentralmacht verhinderten eine wirksame Unterbindung der Werbeaktivitäten. 34
Bis 1774, dem Jahr des Anwerbestopps, folgten 30.623 Ausländer den Versprechungen der russischen Herrscherin. Die meisten Auswanderer stammten aus Westfalen, Hessen, Preußen und Norddeutschland, Sachsen, Baden und anderen deutschen Ländern. Es waren vor allem Protestanten. Kleinere Gruppen kamen aus der Schweiz, Holland, Schweden und Dänemark. Von Anfang an unterliefen die zuständigen russischen Behörden die im Einladungsmanifest versprochene freie Ortswahl, insbesondere wurde eine Niederlassung in Städten verhindert, wo es allerdings bereits größere deutsche Gemeinschaften gab. Man lenkte die Einwanderer größtenteils in die Gegend um Saratov; dort entstanden auf beiden Seiten der Wolga 66 evangelische und 38 katholische Mutterkolonien. Unter den 1769 hier registrierten 23.109 Siedlern waren 12.145 Männer und 10.964 Frauen bei einer durchschnittlichen Familiengröße von etwa 3,6 Personen. Erst nach 1775 verzeichnete man einen Bevölkerungszuwachs, und 1788 betrug die Gesamtzahl der Wolgakolonisten schon 30.962 Personen (15.607 Männer und 15.355 Frauen, Familiengröße etwa 6,5 Personen). 35
War Katharinas Anwerbungsaktion ein Erfolg? Eher nicht, wenn man die pure Zahl in Vergleich zu anderen Immigrantengruppen setzt, oder zur Zahl der deutschen Handwerker und Experten im Gesundheitswesen, der Verwaltung, der Wissenschaft und im Militär, die auch ohne Anwerbung ihr Glück im Zarenreich gesucht und oft auch gefunden hatten. 36Aber sie sicherte Katharinas Reformabsichten in dieser Phase die nötige Aufmerksamkeit in der europäischen Öffentlichkeit und legte den Grundstein für weitere Anwerbungs- und Immigrationswellen in der Zeit Alexanders I. nach Südrussland und ans Schwarze Meer: Russland, so das Ergebnis, war ein attraktiver Ort, der Freiheiten, vor allem religiöse Freiheiten garantierte und damit das Bild autokratischer Herrschaft zumindest in einem Segment aufzuweichen vermochte. Und schließlich waren Katharinas Anwerbungen nur ein Baustein ihrer Peuplierungspolitik in einer frühen Regierungsphase, dem weitere folgen sollten.
In der Außenpolitik verließ sich Katharina auf den Rat Nikita Panins, der in den ersten Jahrzehnten ihrer Regierung starken Einfluss hatte und ein Gegengewicht zu der Fraktion um Grigorij Orlov und dessen Bruder darstellte. Panin war zwar ein Unterstützer Peters III. gewesen und hatte eine Regentschaft Katharinas für ihren Sohn Paul favorisiert. Dies hinderte ihn jedoch nicht, sich loyal ganz in ihren Dienst zu stellen. 37Katharina belohnte ihn mit der Leitung des Kollegiums für Auswärtige Angelegenheiten.
Mit Nikita Panin war sich die Kaiserin darüber einig, dass rund um die Ostsee ein System von Bindungen entstehen sollte, das das dominum maris baltici Russland bringen und zugleich ein Gegengewicht gegen das Haus Habsburg und Frankreich darstellen sollte. Dieses ›Nordische System‹, zeitgenössisch auch »Nordischer Akkord« oder »Ruhe des Nordens« genannt, sah vor, mit Dänemark, Preußen und England Bündnisse einzugehen und Polen und Schweden in politischer Instabilität zu halten. 38Ein solcher Frieden der Ostseeanrainer konnte freie Hand im Süden des Reiches bringen. Diese Sicherheitsarchitektur sollte jedoch nur zum Teil funktionieren. Immerhin gelang es im schwedischen Reichstag, der seit den 1740er Jahren eine sehr starke Position gegenüber dem König in Stockholm hatte, die Fraktionen der Hüte und der Mützen gegeneinander auszuspielen und dadurch Schweden auf mehr als ein Jahrzehnt zu neutralisieren. 39Auch konnte im Frühjahr 1765 eine Defensivallianz mit Dänemark geschlossen werden, und die Regierung in Kopenhagen war froh, einen Krieg gegen Russland um Holstein vermieden zu haben; 40die russischen Truppen, die Peter III. unter dem Kommando des Grafen Rumjancev im Herzogtum Mecklenburg hatte formieren lassen, erhielten von Katharina am 20. Juli 1762 den Befehl zum Rückzug. 41Mehr noch, es gelang ein Ausgleich mit Kopenhagen mit weitreichenden Folgen.
Während der sogenannten Großfürstlichen Zeit Peters und Katharinas war Holstein-Gottorf von Russland aus regiert worden und Katharina hatte hierbei teilweise den Part übernommen, sich von St. Petersburg aus um die innenpolitischen Belange des kleinen und zersplitterten Herzogtums zu kümmern. Peter war allein an der Rückgewinnung der verlorenen Territorien interessiert. Als Zar ernannte Peter III. Caspar von Saldern zum Bevollmächtigten, um mit Johann Hartwig Ernst von Bernstorff, dem dänischen Minister für Schleswig-Holstein, über die Rückgewinnung der herzoglichen Anteile in Schleswig zu verhandeln. Katharina II. hatte nach dem Ausgleich mit Dänemark auch nach einer Lösung der Gottorf’schen Frage gesucht. Für das Herzogtum Gottorf galt die männliche Sukzession. Herzog war also formal der minderjährige Thronfolger Paul. Wie funktional sie ihren Sohn und dessen Rechte sah, sollte sich wenige Jahre nach dem Ausgleich mit Dänemark zeigen.
Die führende Figur in diesem mehrere Jahre andauernden diplomatischen Spiel war der 1761 aus Holstein nach St. Petersburg gekommene Caspar von Saldern. 42Er avancierte zum Vertrauten Nikita Panins, des Erziehers Pauls, und zum Verantwortlichen für die russische Außenpolitik. Von Saldern hatte zwar ein aufbrausendes Wesen – ein französischer Diplomat bescheinigte ihm, die Grobheit eines holsteinischen Bauern mit der Pedanterie eines deutschen Professors verbinden zu können –, 43doch als Diplomat in Russland war er sehr erfolgreich. In Absprache mit Großfürstin Katharina hatte er bereits geschickt die holsteinischen Staatsfinanzen geordnet. 1762 ernannte ihn Zar Peter III. zum kaiserlich russischen Konferenzrat und bevollmächtigten Minister des von Friedrich dem Großen einberufenen Friedenskongresses in Berlin, wo Saldern mit dem dänischen Außenminister Johann Hartwig Ernst von Bernstorff verhandelte. Auch nach dem Sturz Peters III. blieb Saldern in den inneren Zirkeln der Macht. Ende 1762 ernannte ihn Katharina zum Wirklichen Geheimrat und Staatsminister im großfürstlichen Geheimen Rat. Eines von Salderns Hauptanliegen blieb, dass seine holsteinische Heimat nicht mehr Zankapfel der nordischen Großmächte sein sollte. Er setzte sich für eine Verständigung mit England, Preußen und Dänemark ein, ganz im Sinne der Ziele seines Förderers Graf Panin. Im Juli 1768 erreichte Saldern mit dem Gottorfer Vertrag die Einigung zwischen Dänemark und Hamburg über die Reichsunmittelbarkeit der Hansestadt und ihre Unabhängigkeit vom dänisch regierten Herzogtum Holstein. Hierdurch sollte eine Annäherung an England erreicht werden.
Читать дальше