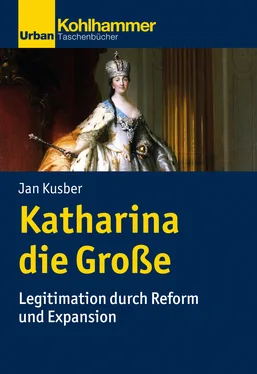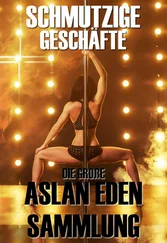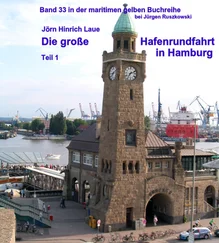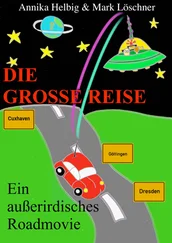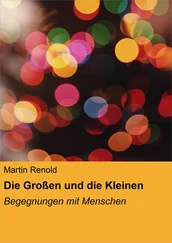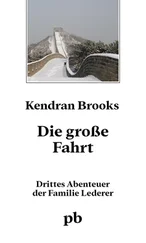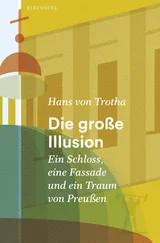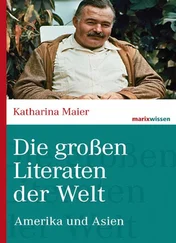Sie wird zwar, sich selbst stilisierend, übertrieben haben, wenn sie die Einförmigkeit ihrer Tage in Arbeit für das Imperium beschrieb – auch dies geschickte symbolische Kommunikation. Aber sie liebte die Arbeit in ihrem Kabinett im Winterpalast, das Studieren von Papieren, in denen die Behörden ihr Bericht zu erstatten hatten, und die Lektüre neuerer Literatur, auch wenn sie manches für das Imperium für brandgefährlich hielt – für die Autokratie und das Russische Imperium. Jean Jacques Rousseaus »Émile« war ein solches Beispiel, dessen Verbreitung sie nach eigener Lektüre verbot. 1Herrscherliches Regieren, informiert zu sein über den Zustand des Reiches und aus diesen Informationen Anweisungen und Gesetze zur Besserung des Staates zu geben – dies sollte ihr als Usurpatorin auf dem Thron Legimitation durch Erfolg verleihen. Und mit dieser Strategie begann sie unmittelbar nach dem Sturz ihres Mannes.
Einen Tag nach dem Tod Peters III., am 7. Juli 1762, verkündete Katharina in einem Manifest, wie sie das Land zu regieren gedachte. Sie wolle
»auf gesetzlichem Wege solche staatlichen Institutionen schaffen, durch die die Regierung unseres lieben Vaterlandes ihren Lauf nehmen kann, auf dass auch in Zukunft jede Staatsbehörde ihre Grenzen und Gesetze zum Zwecke der Wahrung der guten Ordnung habe.« 2
Um zum Beispiel den Erwartungen der Geistlichkeit entgegenzukommen, hob sie die von Peter III. verfügte Verstaatlichung der Kirchengüter wieder auf, obwohl diese Maßnahme ihre Sympathie gehabt hatte. Ein so bedeutender ökonomischer Komplex wie der kirchliche, vor allem der klösterliche Besitz mit seinen Millionen Kirchenbauern gehörte ihrer festen Überzeugung nach unter die Kontrolle des Staates, und so nahm sie schon im folgenden Jahr die Politik ihres Gatten in dieser Hinsicht wieder auf. Sie ließ den Kopf des Widerstandes innerhalb der Geistlichkeit 1763 des Amtes entheben: Bischof Arsenij von Rostov wurde seiner Funktion entbunden und bis zu seinem Tode 1772 in Reval inhaftiert. Ein Synodalgericht unter Leitung des Metropoliten von Novgorod hatte den Prozess geführt und zeigte den Riss, der durch die Kirche ging. 3Gegenüber Voltaire, einem erklärten Feind jeglicher Kirche, erklärte sie in einem Brief im August 1765:
»Die der Kirche untertänigen Bauern, die oft unter tyrannischer Bedrückung leiden, wozu der häufige Wechsel der Herrschaft noch beiträgt, erhoben sich am Ende der Regierung der Kaiserin Elisabeth, und auch bei meiner Thronbesteigung standen noch mehr als hunderttausend Mann unter Waffen. Das veranlasste mich […] die Verwaltung der Kirchengüter völlig neu zu ordnen.« 4
Das las sich für die aufgeklärte Öffentlichkeit in Europa gut: Das Manifest vom 26. Februar 1764, mit dem die Kirchengüter erneut säkularisiert wurden, machte die Kirchenbauern zu Staatsbauern und linderte ihre Lasten, weil Frondienste entfielen und nur noch Zins zu zahlen war. Gleichzeitig sollte es den zahlreichen größeren und kleineren Bauernunruhen im Reich, nicht nur auf Kirchenland, die Spitze nehmen. 5Es schürte aber auch Erwartungen unter den Gutsbauern in Russland, dass Ähnliches auch für sie geplant sein könnte, und erregte entsprechenden Argwohn beim Adel. 6
Dieser Argwohn bestand nicht zu Unrecht, denn die öffentliche Debatte war bereits eröffnet und fiel zusammen mit den Zentralisierungstendenzen katharinäischer Verwaltungspolitik: Die Regierung Katharinas II. zielte von Beginn an darauf, das wirtschaftliche Leben Russlands in Gang zu bringen und die Ausnutzung der wirtschaftlichen Reichtümer des Reiches möglichst rationell und wirksam zu organisieren. Gelehrte Vereinigungen wie die Freie Ökonomische Gesellschaft 7sollten die Debatte hierüber forcieren. Sie glaubte, hierin ganz in petrinischer Manier, dass dieses Ziel nur unter der aktiven Führung, Teilnahme und rationellen Lenkung des Staates erreicht werden könnte. Deshalb mussten alle Territorien den administrativen und sozialen Verhältnissen der zentralen Gouvernements angeglichen und alle lokalen Machtzentren St. Petersburg untergeordnet werden. Das hieß, dass man die partikularen und auf Eigenständigkeit gerichteten Tendenzen im sozialen und kulturellen Bereich bekämpfen und gegen die freie Entfaltung individueller und lokaler autonomer Kräfte angehen musste. Dies war ihre Ansage auf der Reise ins Baltikum und dies war auch ihre Politik in den Gebieten der südlichen Peripherie, in der Ukraine. Auch hier war das Ziel: Territorialisierung durch Vereinheitlichung. 8
Teile der Ukraine, etwa die sogenannte Sloboda-Ukraine um die Stadt Char’kiv, waren schon seit längerer Zeit unter der Herrschaft des Russischen Reiches und in die zwar keineswegs reibungslos funktionierenden, aber doch sehr präsenten imperialen Verwaltungsinstitutionen integriert. Anders sah es in der linksufrigen Ukraine aus, die aus der Perspektive zunächst Moskaus und nun St. Petersburgs als Kleinrussland bezeichnet wurde. Kleinrussland war die Herzkammer der kosakischen Traditionen. Die Zaporoger Kosaken entlang des Dnjepr-Laufes waren im Vergleich zu anderen kosakischen Gemeinschaften etwa am Don oder am Jaik die zahlenmäßig stärkste – und unruhigste.
Auch als 1654, nach dem Aufstand ihres Hetmans Bohdan Chmiel’nickij im Akt von Perejaslav, die Anerkennung der Oberhoheit der Zaren erfolgt war – von den Kosaken als ein gegenseitiges Dienst- und Schutzverhältnis interpretiert, von den Zaren aber als eine hierarchische Unterstellung –, blieb Kleinrussland rechtlich und sozial separiert. Hier galt nicht das Gesetzbuch von 1649, sondern es galten das litauische Statut und lokale Rechtskreise. Die Kosaken in ihren Siedlungen waren nach dem Hundertschaftsprinzip organisiert und bestimmten sich abgestuft selbst. Die kosakische Oberschicht, die zunehmend über Grundbesitz verfügte und in seiner Lebensweise dem Adel immer ähnlicher wurde, hatte mit den agrarisch wirtschaftenden Unterschichten ein gemeinsames Eigenbewusstsein, das in mancherlei Hinsicht protonational genannt werden kann. 9Hetman Mazeppa, der sich im Großen Nordischen Krieg gegen Peter den Großen wandte und gemeinsam mit Karl XII. in Poltava 1709 verlor, galt für das Imperium als Verräter, in ›Kleinrussland‹ jedoch als Held. Je nach politischer Konjunktur und Gelegenheit wichen Kosaken in den Machtbereich des Osmanischen Reiches, zu den Krimtataren oder aber nach Polen-Litauen aus. Organisiert in Kosakenlinien übernahmen sie Grenzschutzfunktionen für das Imperium im Süden. Die Leibeigenschaft existierte in der Form von Bindung der Person durch Leib an den Gutsherren und dessen Boden nicht. 10
Katharina waren die Eigenrechte des Hetmanats ein Dorn im Auge. So wie sie für das Baltikum bei aller Wertschätzung eine Uniformierung anstrebte, so wollte sie bei aller Wertschätzung der ukrainischen Kultur, die schon am Hofe Elisabeths populär war, eine rechtliche Angleichung. Dies war nicht einfach, denn sie war dem Hetman Kyrill Razumovskij, den sein älterer Bruder Aleksej, Favorit Elisabeths, installieren konnte, durch seine Unterstützung im Putsch verpflichtet. Kyrill war der französischen Hofkultur und den ukrainischen Traditionen gleichermaßen zugetan, inszenierte sich in seiner kleinrussischen Residenz Gluchov herrscherähnlich und spiegelte gleichsam den Petersburger Hof. Zugleich arbeitete er geschickt mit der Starščina, der Oberschicht der Kosaken, die sich wegen Katharinas Wunsch nach Zentralisierung in Gärung befand. Razumovskij und die Kosakenoberen formulierten in Gluchov im Oktober 1763 eine Petition, in der sie eine weitgehende Autonomie ›Kleinrusslands‹ und die Erblichkeit des Hetmanats für die Familie Razumovskij forderten. 11Katharina hätte sich mit einem energischen Vorgehen nicht so schwergetan, hätte nicht Kyrill Razumovskij zu ihren Freunden in der Großfürstinnenzeit und zu den Mitorganisatoren des Umsturzes gehört. Kyrill Razumovskij war, zum Ärger des eifersüchtigen Grigorij Orlov, Katharina sehr zugetan und sie schätzte ihn außerordentlich als Mann von Intellekt – ihr Favorit war er freilich nie.
Читать дальше