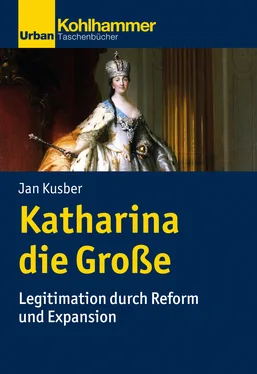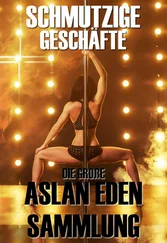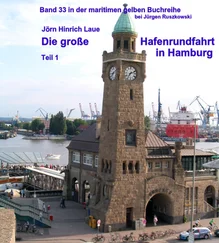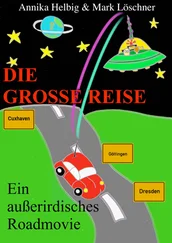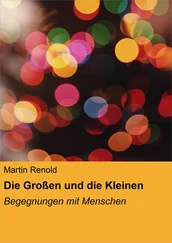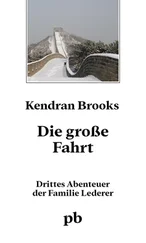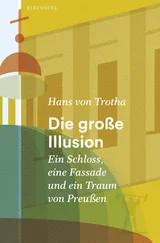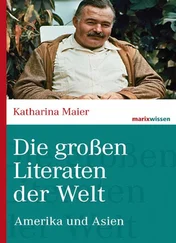Eines machte der Wettbewerb Katharina jedoch deutlich: Aus den Einsendungen ging hervor, dass das Rütteln an der Leibeigenschaft die Sozialverfassung des Reiches insbesondere in seinem russischen Kernland zu erschüttern vermochte. Dies konnte und wollte sie sich, gerade an die Macht gekommen, kaum leisten. Manche Maßnahmen Katharinas im Jahr 1766 zeigten dies deutlich. So bestätigte sie im Januar des Jahres das Recht der adligen Grundbesitzer, aufsässige Bauern nach Sibirien zu verbannen; in ihrer Vermessungsinstruktion vom 25. Mai hob Katharina das Eigentumsrecht der nordrussischen Staatsbauern an Grund und Boden auf und erklärte das Land zu Staatseigentum: Rechtliche Angleichung diente als Argument, aus Sicht dieser bäuerlichen Gruppe bedeutete dies jedoch eine Schlechterstellung. Auf der anderen Seite untersagte Katharina im gleichen Jahr den Kauf von Bauern, die dann von ihren neuen adligen Herren gleich als Rekruten in die Armee geschickt wurden, um die eigenen, leistungsfähigeren Bauern zu schonen. 23Katharina behielt das Problem des bäuerlichen Grundbesitzes und der Leibeigenschaft auf der Agenda, die sie auch der Gesetzbuchkommission mit auf den Weg geben sollte.
Andere wirtschaftspolitische Maßnahmen waren viel eher umzusetzen. Wohlstand, florierende Agrarproduktion, ein sich dynamisch entwickelndes Manufakturwesen sowie eine wachsende Bevölkerung sollten zur Entwicklung des Imperiums und zu dessen Ruhm beitragen. Peter I., Katharinas Bezugsgröße unter Russlands Herrschern, hatte seine wirtschaftspolitischen Reformen ganz utilitaristisch gesehen und immer nach dem Nutzen für seine Kriege, insbesondere den Großen Nordischen Krieg gefragt. Katharina und ihre Berater dachten diesen Zusammenhang nicht so eng, aber ein prosperierendes Imperium setzte auch die internationale Handlungsfähigkeit voraus – im Krieg und im Frieden.
Die Einladung von Ausländern war Teil eines bevölkerungspolitischen Gesamtkonzepts. 24Die Zarin, ihre Ratgeber und Beamten beriefen sich – ganz auf der Höhe ökonomischen Wissens – auf europäische, besonders deutsche Peuplierungsideen, die von Bevölkerungsreichtum und Ansiedlung als Quelle ökonomischen Wohlstands ausgingen, und orientierten sich an der Praxis Preußens, Österreichs oder Dänemarks. In der Kameralwissenschaft der Zeit, die Katharina kannte und sich zu eigen machte, ging es um die Frage, wie das Vermögen des Staates erhalten und vermehrt werden könne. 25Den ersten der drei Hauptwege zur Vergrößerung des Reichtums sah Johann Heinrich Gottlob von Justi 1755 in der Vermehrung der Einwohner des Landes, besonders »durch fremde bemittelte Personen«, denn diese »zieht nicht nur Vermögen mit ihnen ins Land, sondern befördert auch den Umtrieb des Geldes, als worauf es in dem wahren Reichtum des Staates hauptsächlich ankömmt«. 26Fremde kämen und Einheimische blieben in einem Staat, der gut und mild regiert werde, persönliche Freiheit garantiere, Gewerbe und Manufakturen fördere. Die Ausländer sollten befristet von Abgaben befreit und mit Baumaterialien, Geräten und Krediten unterstützt werden. Katharina II. stellte die Ansiedlung von Ausländern auf eine neue, gesetzliche Grundlage. In ihrem ersten Manifest vom 4. Dezember 1762 versprach sie allen Ausländern, ausgenommen Juden, die sich in Russland niederzulassen wünschten, Schutz und Wohlwollen, und allen russischen Flüchtlingen, die in die Heimat zurückkehrten, Vergebung. 27Mit diesen allgemeinen Wendungen konnten ihre diplomatischen Vertreter im Ausland wenig anfangen und drängten deshalb zu einer schnellen Entscheidung darüber, welche konkreten Zusagen sie den Interessenten machen wollte und wohin die Siedler geschickt werden sollten. Die Kaiserin reagierte prompt mit einem weiteren Manifest vom 22. Juli 1763. 28Es sollte viel größere Bedeutung für ihre Regierung erlangen und legte in der Präambel noch einmal die Grundzüge der bevölkerungspolitischen Werbemaßnahmen dar:
»Das Uns der weite Umfang der Länder Unseres Reiches zur Genüge bekannt, so nahmen Wir unter anderem wahr, daß keine geringe Zahl solcher Gegenden noch unbebaut liege, die mit vorteilhafter Bequemlichkeit zur Bevölkerung und Bewohnung des menschlichen Geschlechtes nutzbarlichst könnte angewendet werden, von welchen die meisten Ländereyen in ihrem Schoose einen unerschöpflichen Reichtum an allerley kostbaren Erzen und Metallen verborgen halten; und weil selbiger mit Holzungen, Flüssen, Seen und zur Handlung gelegenen Meerung genugsam versehen, so sind sie auch ungemein bequem zur Beförderung und Vermehrung vielerley Manufacturen, Fabriken und zu verschiedenen Anlagen.
Dieses gab Uns Anlaß zur Erteilung des Manifestes, so zum Nutzen aller Unserer getreuen Unterthanen den 4. December des abgewichenen 1762 Jahres publiciert wurde. Jedoch, da wir in selbigen Ausländern, die Verlangen tragen würden, sich in Unserem Reich häuslich niederzulassen, Unser Belieben nur summarisch angekündiget; so befehlen Wir zur besseren Erörterung desselben folgende Verordnung […].« 29
Die Leere des Landes als Argument: Hier hatte Katharina vor allem den Süden ihres Reiches im Blick, also jene Gebiete, die, wie das Hetmanat, weniger fest im Reichsverband integriert und in der die Schicht sesshafter Bauern geringer war. Ansiedlungen sah sie zudem als Mittel gegen nomadisierende Bevölkerungsgruppen an den Peripherien des Reiches. Aber auch in anderen Regionen und Städten waren Ausländer willkommen. Keineswegs dachte sie nur an Migranten aus dem deutschsprachigen Raum: Das Manifest wurde immerhin in mehreren europäischen Sprachen veröffentlicht. Und Serben, Griechen und andere Flüchtlinge aus dem Herrschaftsbereich des Osmanischen Reiches waren bereits unter den Kaiserinnen Anna und Elisabeth im Grenzsaum des Russischen Reiches angesiedelt worden. Im Zuge der Südexpansion des Russischen Reiches sollte ihnen auch weiterhin Aufmerksamkeit geschenkt werden. 30Katharina galten jedoch auch die deutschen Territorien wie schon das Baltikum als »Reservoir tüchtiger Menschen«. 31Hier wusste sie um gut ausgebildete Spezialisten, die bereits Peter I. interessiert hatten und die hier wie in Europa angeworben worden waren. Katharina ging es aber darüber hinaus auch um Siedlerfamilien für die Landwirtschaft. Ganz in Sinne der physiokratischen Gedankenwelten des Jahrhunderts sah sie die Landwirtschaft als Grundlage für Manufakturwesen, Gewerbe und Handel.
Um nun neben Fachleuten auch Bauern zur Migration zu bewegen, machte sie konkrete Zusagen: Alle Ausländer – diesmal wurden die Juden nicht mehr ausgeschlossen – könnten sich entweder direkt bei der »Vormundschaftskanzlei für Ausländer« (Kancelarija opekunstva inostrannych) und den Grenzbehörden melden oder sich wegen der Reisekosten zunächst an die russischen Auslandsvertreter wenden. Wenn sie sich als Kaufleute oder Handwerker in einer Stadt niederließen, würden sie für zehn, in den beiden Haupt- und den baltischen Städten für fünf Jahre von allen Abgaben, Diensten und der Einquartierung befreit. Der Fiskus werde bei der Gründung von Fabriken und Werkstätten, vor allem solcher, die es in Russland noch nicht gebe, mit Krediten helfen. Neue Produkte dürften zehn Jahre lang ohne jeglichen inneren oder Hafen- und Grenzzoll verkauft und ausgeführt werden. Wer als Fabrikant ohne staatliche Kredite auskomme, solle die erforderlichen Leibeigenen und Bauern kaufen dürfen. Wer sich auf bisher unbebautem Land in neuen Kolonien ansiedeln wolle, solle Land und Vorschüsse zum Bau von Häusern und Kauf von Vieh und Geräten erhalten, von Diensten und Abgaben zunächst zehn Jahre befreit sein und den Wohnort frei wählen können, wobei Gebiete zur Ansiedlung um die Stadt Saratov an der Wolga angeboten wurden. Sie wurden vom Militärdienst befreit und erhielten das Recht der freien Religionsausübung und Gemeindegründung, wobei keine Klöster gegründet werden durften. Hier hallte die Säkularisierung des Kirchenlandes mit dem vielen Klosterbesitz nach.
Читать дальше