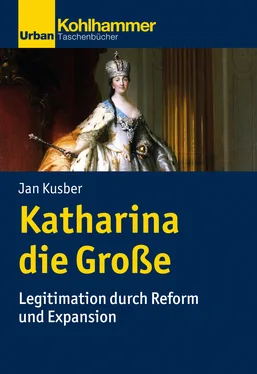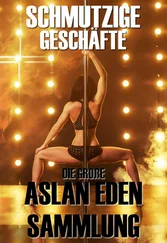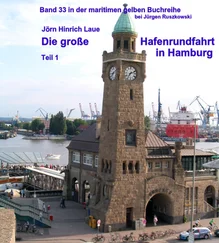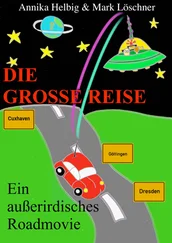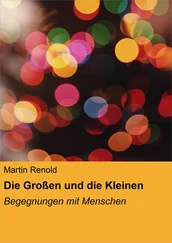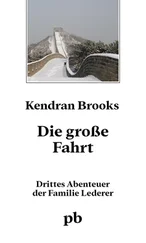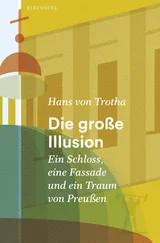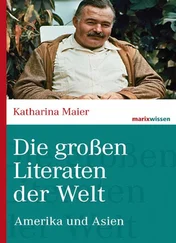Katharinas politische Haltung gegenüber ›Kleinrussland‹ war unzweifelhaft: Sie wollte die russische Provinzialadministration und das Sozialsystem übertragen. Dies bedeutete auch die Ausweitung der Gutswirtschaft und der Leibeigenschaft als Plan. Ihre Schriften in diesem Zusammenhang geben auch Auskunft über ihr fortgesetztes Nachdenken über die Leibeigenschaft, die sie in diesem Zusammenhang ganz aus der Perspektive des ökonomischen Nutzens für das Imperium betrachtete. ›Kleinrussland‹ trug wenig zum Steueraufkommen des Imperiums bei und dies, obwohl die Böden sich bestens für landwirtschaftliche Nutzung, vor allem Getreide eigneten. Die ukrainischen Bauern waren frei oder konnten zumindest ihren Dienstherren beliebig wechseln. Auch die landbesitzende adelsähnliche Kosakenoberschicht hatte ein Interesse daran, diese Mobilität zu unterbinden, um so für kontinuierliche Landbewirtschaftung zu sorgen. In ihren schriftlichen Ausführungen legte die Monarchin Wert auf den Umstand, dass in dem einzuführenden System nicht der Bauer dem Grundherrn gehöre, sondern lediglich an das Land gebunden sei, was sie nicht als leibeigen im engeren Sinne bezeichnet wissen wollte – Katharina wollte dem Vorwurf mancher Aufklärer entgehen, sie unterstütze die ›Sklaverei‹. 12
Diese Haltung wurde etwa von ihrem Sekretär Grigorij Teplov unterstützt, der in einem Memorandum die Gründe für eine Aufhebung der Sonderrechte darlegte und das Ansinnen der Petition der kleinrussischen Eliten und ihres Hetmans zurückwies. 13Die linksufrige Ukraine sei nicht, wie insinuiert, lediglich durch die Person der Kaiserin mit Russland verbunden, sondern ein integraler Bestandteil Russlands von alters her. Verwaltung und Sozialverfassung seien daher anzugleichen. 14
Kyrill Razumovskij befand sich in der Zwickmühle. Einerseits wollte er sich nicht offen der von ihm bewunderten Kaiserin widersetzen, und es gab auch Stimmen in den kleinrussischen Eliten, die sich von einer vollkommenen Integration Karrierevorteile und ökonomischen Gewinn versprachen; andererseits fürchteten viele das Ende der Freiheiten der Autonomie in der komplexen Form, wie sie die Kosaken entwickelt hatten. Der Druck des Petersburger Hofes wurde schließlich zu stark. 1764 stellte Razumovskij sein Amt als Hetman zur Verfügung und ging von 1765 bis 1767 auf eine Auslandsreise. Einen Bruch mit Katharina bedeutete dies nicht. Sie fand ihn mit weiteren Gütern in Kleinrussland ab, und als Präsident der von Peter dem Großen initiierten Akademie der Wissenschaften und in anderen Funktionen sollte er weiterhin eine bedeutende Rolle in Politik und Hofleben spielen.
Im November 1764 richtete sie das ›Kleinrussische Kollegium‹ ein, das von Petersburg aus die Integration der Ukraine vorantreiben sollte. Zu seinem Präsidenten ernannte sie General Petr Rumjancev, der ihr nach dem Sturz zunächst kritisch gegenübergestanden hatte, aber nun in ihr Netzwerk eingebunden werden sollte. Rumjancevs Wahl war auch ein Signal an die kleinrussischen Eliten, hatte er doch seine Jugend in der Ukraine verbracht. 15Das Hetmanat und die Autonomie der kleinrussischen Ukraine waren abgeschafft, und die verstärkte Expansion des leibeigenschaftlichen Systems in diese Gebiete begann zu dem Zeitpunkt, als es im Russischen Imperium verstärkt in die Diskussion geriet.
Die Zeitgenossen sahen diese Probleme durchaus: Nicht umsonst wurde es zur Aufgabe der 1765 gegründeten Freien Ökonomischen Gesellschaft, sich dieser Probleme anzunehmen und regionalspezifische Lösungsansätze zu erstellen. Die gelehrte Gesellschaft erfreute sich nicht nur des Wohlwollens Katharinas, sie ventilierte gleichsam die Möglichkeiten der Reformen im Russischen Imperium. Ihr Mitgliederkreis bestand aus aufgeklärten Bürokraten, großgrundbesitzenden Höflingen Katharinas, Akademiemitgliedern und korrespondierenden Mitgliedern im Ausland, in Deutschland, Dänemark, Schweden und England. Sie stellte, wenn man so will, einen brain trust der Aufklärung mit einem über ganz Europa reichenden Netzwerk dar. Diese Gesellschaft, die das Jahrhundert der Aufklärung in ihren Gründungsstatuten als das »ökonomische Jahrhundert« bezeichnete, verschrieb sich unter Hinweis auf ähnliche Anstrengungen in Dänemark und Schweden wesentlich der Förderung des Agrarsektors. 16
Diese Gesellschaft schrieb nun 1766 mit Billigung der Kaiserin einen Wettbewerb unter der Frage aus, ob der Bauer produktiver arbeite, wenn er das Land, das er bearbeite, selbst besitze oder nicht. Die Preisfrage lautete:
»Ist es dem gemeinen Wesen vorteilhafter und nützlicher, daß der Bauer Land oder nur bewegliche Güter zum Eigentum besitze, und wie weit soll sich das Recht des Bauern über dieses Eigentum erstrecken, damit es dem gemeinen Wesen am nützlichsten sei?« 17
Der Hintergrund war eine von der Zarin gewünschte Diskussion über die Aufhebung der Leibeigenschaft, die rund um die Ostsee, in Dänemark, Schleswig-Holstein, der noch existierenden Adelsrepublik Polen sowie in Livland, Estland und Kurland intensiv geführt wurde. Katharina wollte die Diskussion von der Hauptstadt aus gezielt vorantreiben und steuern und auch die Russen über den aufgeklärten Diskurs dazu bewegen, gleichsam von selbst Schritte zur Aufhebung der Leibeigenschaft vorzuschlagen.
Die Kaiserin sah die menschenverachtenden Auswüchse der Leibeigenschaft sehr wohl: 1762, im Jahr der Machtübernahme, fiel Katharina eine Bittschrift in die Hände, in der die Quälerei von Hausleibeigenen beklagt wurde. Die Gutsherrin Darja Saltykova sollte, so die Bittschrift, ihre Hausleibeigenen derart misshandelt haben, dass sie an den Folgen gestorben seien. Die Kaiserin ging dem Fall nach; es zeigte sich, dass diese Bittschrift bereits die 21. aus dem Gut der Saltykova gewesen war. Die Kaiserin ließ ein Exempel statuieren und einen Prozess anstrengen, der mit der Verbannung der Adligen nach Sibirien und der Einziehung des Gutes endete. Der Fall erregte Aufsehen; er sollte aber kein Einzelfall bleiben. Die Kaiserin sollte in ihrer Herrschaft in 20 Fällen die Einziehung von Gütern wegen Vergehen gegen die Leibeigenen billigen. 18
Umso gespannter wartete sie auf die Ergebnisse des Wettbewerbs der Freien Ökonomischen Gesellschaft: Aus der Perspektive Katharinas war das Resultat ernüchternd. Zwar gingen 164 Einsendungen ein, doch nur eine verschwindend geringe Zahl stammte aus der Feder von Russen. 19Mehrere Beiträge kamen aus den baltischen Provinzen, unter anderem von Johann Georg Eisen und Timotheus von Klingstedt. Es zeigte sich, dass kaum ein russischer Beitrag ein Eigentum der Bauern oder gar die persönliche Freiheit der Leibeigenen befürwortete, wie dies in einigen ausländischen Einsendungen gefordert wurde. Bemerkenswert für die kulturell-akademische Ausstrahlung St. Petersburgs und der neuen Gesellschaft ist jedoch das Maß an Vernetzung, das zwischen den beteiligten Akademien in Kopenhagen und St. Petersburg oder den ökonomischen und gelehrten Gesellschaften in Riga und Glücksburg bestand. Die Transferwege von den Zentren der französischen, britischen und deutschen Aufklärung nach Kopenhagen, Stockholm, Warschau, Riga, St. Petersburg oder Moskau funktionierten und konsolidierten sich auch über diesen Wettbewerb. 20Dass Katharina II. die baltische Variante der Aufklärung rezipierte, wiewohl sie über ausgezeichnete Verbindungen direkt nach Paris, Göttingen und Halle verfügte, erstaunt weniger als die Tatsache, dass gerade über die Agrarfrage ein Austausch zwischen Kopenhagen und St. Petersburg stattfand, dass Preisschriften an den dänischen König geschickt wurden und dass der in dänischen Diensten stehende Georg Christian Oeder nicht nur einen Wettbewerbsbeitrag, sondern auch gesammelte dänische Publizistik zur Agrarfrage nach Russland sandte. Johann Georg Eisen etwa verwies in seinen Traktaten immer wieder auf schwedische und dänische Beispiele zur Agrarverfassung. 21Die Beteiligten schöpften aus dem gleichen Fundus an aufgeklärter Literatur, seien es Quesnay, Justi oder Kant, tauschten sodann jedoch ihre jeweils landesspezifischen Adaptionen aus. »Die Leibeigenschaft contrastirt zu sehr mit dem Geist des Zeitalters«, 22um es in einer Stimme der Aufklärung zusammenzufassen, und auf diese Lesart konnte man sich unter gebildeten Aufklärern rund um die Ostsee einigen. Das Auseinanderklaffen von Projekt und Realität war diesem Diskurs jedoch ebenso immanent wie die Auffassung, mit rational-wissenschaftlichen Auseinandersetzungen positiv verändernd wirken zu können.
Читать дальше