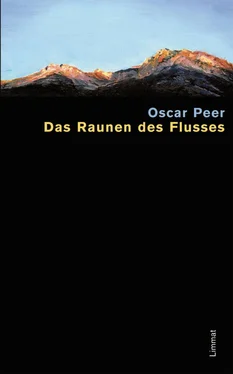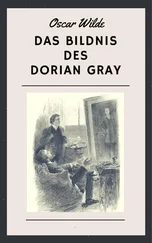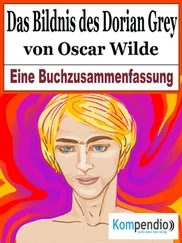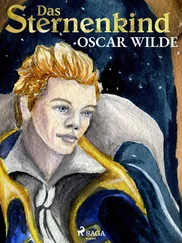Leidenschaften ... Vielleicht sind sie es, die uns über die Dauermühsal des Lebens hinweghelfen. Mein Vater zum Beispiel hätte in Sachen Leidenschaften eine Balzac-Figur sein können. Auch Mutter waren sie nicht fremd, im Gegenteil. Zum Beispiel eben das Zeitungslesen, das Briefeschreiben, das Kuchenbacken, die Haustiere. Dann vor allem Pilze und Beeren. Preisel- und Heidelbeeren gab es in höher gelegenen Regionen, Himbeeren, Hagebutten und Holunder auch unten im Tal. Sie wusste, wo sie zu finden waren, schweifte dann tagelang durch verlassene Schluchten, an Waldrändern und Geröllhalden entlang. Sie dachte an die Beeren, war aber dabei wohl unbewusst von Naturmagie durchdrungen. Oft vergass sie dann, nach Hause zu gehen, liess sich von der Nacht überraschen. Wir warteten mit dem Essen auf sie, man forderte mich auf, ihr entgegenzugehen. Ich wanderte bis zum Dorfausgang, wo die Strassenbeleuchtung aufhörte und sich die Dunkelheit verdichtete. Dort blieb ich stehen, zählte bis hundert, dann bis zweihundert. Je nachdem kam noch ein Bauer vom Feld, ich fragte ihn, ob er meine Mama gesehen hätte; wenn er verneinte, ging ich ein Stück weiter, bis zu einer Weggabelung, wo ich, um sie nicht zu verpassen, Halt machen musste. Ich wartete wieder, begann zu rufen. Wenn ich endlich im Dunkeln ihre Gestalt auftauchen sah, schwand die Beklemmung dahin und ich atmete auf.
Im Gegensatz zu Vater, der gewisse Besucher (besonders die vornehmeren und gut gekleideten) nicht leiden mochte, war sie ausgesprochen gastfreundlich, und zwar schätzte sie gerade die Gebildeten – einen bekannten Zürcher Professor, einen Zeitungsredaktor aus Bern, der hier mit der Familie Ferien verbrachte, ein Ehepaar aus Florenz –, Leute, die einen Hauch von Urbanität ins Haus brachten. Sie wusste sie würdig zu empfangen, bewirtete sie mit Kaffee und selbstgebackenen Kuchen, zeigte ihnen unsere Stube mit dem alten Nussbaumschrank, die grosse Bibel aus dem siebzehnten Jahrhundert, führte die Gäste sogar in den Stall. Sie sollten nur sehen, was es in ihrem Haus gab und worauf sie stolz war – ihre grossäugigen Kühe, die Kälblein, Ziegen und Schafe; vor allem auch die grosse Sau mit ihren zwölf oder vierzehn Ferkeln, die ihr besonders am Herzen lag. Sie betrat den Koben, streute frisches Stroh hinein, hob eines der noch frisch duftenden Schweinchen auf und zeigte es den Gästen, sagte ihnen, sie sollen es mit der Hand streicheln. «Das interessiert doch die Leute nicht!», meinte Vater. Er täuschte sich, es interessierte sie sogar sehr, nicht nur die rührenden Ferkel mit dem geringelten Schwanz, sondern der ganze Stall, der Geruch von Heu und Mist und tierischer Wärme – ein einfacher Stall wie zu Bethlehem, was sie noch nie im Leben gesehen hatten.
Einzig mit einer Besucherin (wir nannten sie Tante Didi) hatte auch sie Mühe, weil die Frau zu viel redete. Sonst eine liebe Person, eine gut aussehende Fünfzigerin mit lebendigem Gesicht und grossen braunen Augen, nur konnte sie einen mit ihrer Redseligkeit fertigmachen. Zuerst, wenn sie erschien, war man von ihr angetan, sie hatte einen gewissen Charme. Man setzte sich zu Tisch, sie begann zu erzählen, und das konnte sie ausgezeichnet. Nur hörte es nie auf, es ging immer weiter, über die Mahlzeit hinaus, stundenlang, sie redete und redete, schilderte uns Leute, denen sie irgendwo in der Welt begegnet war, sie erzählte, was diese Leute ihr erzählt hatten, was ihnen widerfahren war, rührende, lustige oder schreckliche Geschichten. Sie wusste noch alles bis in kleinste Details, hatte leider ein phänomenales Gedächtnis.
Man hoffte umsonst, dass sie gelegentlich alles gesagt hätte, denn der Vorrat war unerschöpflich. Ein lockeres Gespräch gab es nie. Wenn Adrian oder Vater einmal das Wort an sich rissen, um ihren Redefluss zu stoppen, mimte sie Aufmerksamkeit, lächelte ins Leere, wobei man genau merkte, wie sich hinter ihrer konkaven Stirn eine neue Geschichte bereithielt und dann unweigerlich auch kam. Man war blockiert, ermüdet, und gegen Mitternacht glücklich, ins Bett zu gehen. Doch am nächsten Morgen ging es weiter.
Adrian, damals schon Student, behauptete, diese Redebesessenheit sei wahrscheinlich eine Form verdrängter Sexualität. «Schade», sagte Mutter, «sie meint es sicher gut, aber ich habe einfach keine Zeit, ihr den ganzen Tag zuzuhören.» Sie ging trotz allem ihrer Arbeit nach, spülte das Geschirr oder bereitete das Schweinefutter, während Didi neben ihr stand und redete. Wenn Mutter mit dem Schweinefutter in den Stall ging, kam sie mit und plauderte weiter, um die angefangene Geschichte nicht unterbrechen zu müssen.
Einmal hatte Mama genug, hörte ostentativ nicht mehr zu, liess die Erzählerin mitten in ihrer Geschichte stehen und ging hinaus. Später, als Didi wieder loslegte, sagte sie trocken: «Entschuldige, ich habe jetzt leider keine Zeit.» Abends bei Tisch merkten wir, dass etwas nicht mehr stimmte, Tante Didi schwieg, ging nach dem Essen gleich zu Bett. Tags darauf, als sie mit Mutter allein war, fragte
sie: «Was ist eigentlich los? Störe ich euch? Habe ich etwas falsch gemacht? Ich wäre froh, wenn du es mir ganz offen erklärtest.»
«Es tut mir leid, Didi», sagte Mutter, «ich möchte dir nicht wehtun, aber du redest zu viel ... Es ist sicher interessant, was du sagst, aber du machst einen fertig. Es gibt auch keinen Dialog mit dir, du stellst kaum je eine Frage, du redest einfach drauflos. Im Grunde hast du dein Leben zerschwätzt ...»
Es half nichts, dass sie sich später entschuldigte. Noch am selben Tag packte die Besucherin ihre Koffer, kam damit die Treppe herunter, verabschiedete sich von Mutter im Hausgang. Sie umarmten sich flüchtig, beide mit nassen Augen. Ich begleitete die Frau mit ihrem Gepäck an den Bahnhof, wo sie mir etwas Geld zusteckte und mich bat, Mutter auszurichten, sie danke ihr für die Gastfreundschaft.
Später wurden zwischen ihr und Mutter trotz allem noch Kartengrüsse gewechselt. Freundschaft auf Distanz, doch sahen sie sich nie wieder.
Besondere Anteilnahme zeigte sie für Randexistenzen, für Gestrandete oder Ausgestossene. Zum Beispiel für Veronica C., die sie während ihres ersten Ehejahres in Sent kennen lernte, eine Frau, die dort als Hexe verschrien war, zwanzigstes Jahrhundert hin oder her. Natürlich wurde Veronica nicht gefoltert und nicht verbrannt, das gab es zum Glück nicht mehr, aber sie war geächtet.
Die Frau hatte einfach Pech gehabt. Man suchte offenbar eine Hexe und man fand sie; drei oder vier zufällige Vorkommnisse genügten, zudem fand jemand auch, sie habe den bösen Blick: Ein Steuereinnehmer, der ihr in ihrer eigenen Stube ihr letztes Bargeld abgezwackt hatte, wobei es zu einem Streit gekommen war, glitt beim Verlassen des Hauses auf der Türschwelle aus, fiel hin und verrenkte sich den Fussknöchel. Einem Bauern, der mit einer Heuladung vom Feld kam, war das Fuder, auf dem er selber sass, unmittelbar vor Veronicas Haus umgestürzt, und zwar gerade, als Veronica zum Fenster herausschaute; er hatte sogar deutlich gehört, wie sie dabei lachte. Ein Kaminfeger, der ihren Stubenofen putzte, zog sich eine Gasvergiftung zu. Und zu guter Letzt, als Veronica im Spätherbst nach Italien verreist war, wo sie jeweils den Winter verbrachte, entdeckte jemand, dass zuhinterst in ihrem Hausflur ein kleines Licht brannte. Es brannte den ganzen Winter hindurch, doch kurz bevor Veronica im folgenden Frühling wieder zurückkam, war es plötzlich erloschen. Jetzt schien alles klar. Man wich ihr aus, man grüsste sie kaum mehr.
Mein Vater, selber in Sent aufgewachsen, traute ihr auch nicht. Mutter fand das lächerlich, vor allem unmenschlich. Als sie eines Sonntags zum Gottesdienst ging, war die Kirche schon voll (das gab es damals noch), eine einzige Bank leer, und dort zuhinterst sass Veronica, allein. Es herrschte Stille, doch wie Mutter sich zu ihr setzte, ging durch den Raum ein Gemurmel. Jemand berührte von hinten ihre Schulter, flüsterte: «Hier wäre noch ein Platz frei.» Sie blieb sitzen, die Glocken verstummten, der Pfarrer erschien auf der Kanzel. Während der Predigt bemerkte sie immer wieder Leute, die sich nach ihr umwandten.
Читать дальше