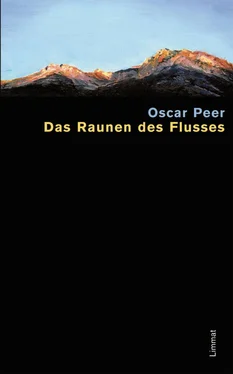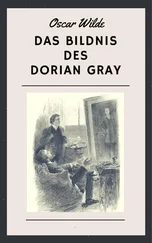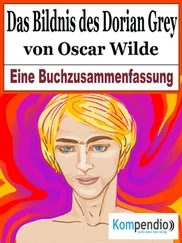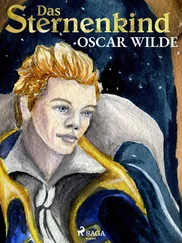Nach der Mahlzeit benetzte Mutter ihr Taschentuch und putzte mir den Mund. Sie lehnte mit dem Rücken am Zaun, ich lag neben ihr, mit dem Kopf auf ihrem Schoss. Morgens waren wir früh aufgestanden, jetzt nickten wir bald ein und schliefen eine ganze Weile. Doch plötzlich fuhr sie zusammen und sprang auf. Wir mussten uns beeilen, rannten über das Feld in Richtung Dorf, sie zog mich mit sich fort, einmal fiel ich hin, darauf trug sie mich ein Stück weit. Wir betraten ein Haus, das sich gerade neben der Konditorei befand. Während sie sich dann stundenlang vom Zahnarzt behandeln liess, schlief ich in einem Zimmer mit rosafarbenen Tapeten. Ich erinnere mich nicht mehr, wie man mich dort zu Bett brachte, sondern nur an mein Erwachen: ein Fräulein in weissem Kittel kam lächelnd auf mich zu, sagte etwas auf Deutsch, nahm mich auf den Arm und verliess mit mir das Zimmer. Unten wartete Mama.
In St. Moritz wohnte ihre Schwester Ottilia. St. Moritz grenzte ans Märchenhafte: unten der schimmernde See, oben die schlossähnlichen Gebäude mit Türmen und Terrassen. Es gab rötliche Plätze, wo Männer und Fräuleins miteinander Ball spielten; es gab duftende Bäckereien, zauberhafte Schaufenster, Warenfülle – ein Schlaraffenland, man hätte sich durch Berge von Pralinen, Kuchen und Bananen hindurchfressen mögen. Auf den Strassen Fahrzeuge mit oder ohne Dach, Pferdekutschen, Kummetgeklingel. Die Leute grüssten nicht. Mutter sagte: «Hier reden sie nicht mehr romanisch, hier wimmelt es von Fremden, und die sind anders als wir.» Sie hatten glättere Gesichter, waren anders gekleidet, sie bewegten sich mit einer gewissen Trägheit; manche trugen Sonnenbrillen, irgendeine buntscheckige Mütze. Man sah Frauen mit blutroten Lippen, und mir schien, dass sie ihre Münder bewusst nach vorn hielten, damit man sie besser sehe. Es gab sogar alte Frauen mit solchen Lippen, wobei das Rot merkwürdig von ihren bleichen Gesichtern abstach.
In einer Parkanlage nahe der Strasse sass ein Fräulein auf einer Bank, neben ihr ein älterer Herr, der sie um die Schulter hielt und ihre Haare streichelte. Das Fräulein war mir aufgefallen, weil sie nicht nur die Lippen, sondern das ganze Gesicht gefärbt hatte – die Wangen rötlich, die Augenlider wie mit Grafit bemalt und zudem dunkel umrandet, Brauen und Wimpern schwarz –, so dass ich zuerst glaubte, sie trage eine Maske. Sie schien traurig zu sein, weshalb ihr der ältere Herr das Haar streicheln mochte. Vielleicht starrte ich sie an, denn plötzlich zeigte sie mit dem Finger auf mich und begann zu lachen. Mutter zog mich mit sich fort, einige Schüler lärmten an uns vorbei, einer von ihnen warf seine Schultasche weit von sich auf die Strasse, ein Auto hupte. Irgendwo hörte man Musik, dann gerade über den Dächern das Gesurre eines Flugzeugs.
Der Ort hatte etwas Verwirrendes. Auf dem Dorfplatz, mitten im Mittagsverkehr, blieb Mutter auf einmal stehen: ein gewisser Onkel, den ich nicht kannte, war hier Polizist und hatte offensichtlich etwas mit diesem Verkehr zu tun. Sie sagte: «Siehst du dort drüben – das ist Onkel Gisep!» Der Mann stand, in grüner Uniform und mit weissen Handschuhen, auf einem Podest, gestikulierte mit Armen und Händen, schien den Automobilisten Befehle zu erteilen. Die Autos kamen von verschiedenen Seiten, einzelne blieben stehen, andere fuhren los und überquerten den Platz; er winkte, spedierte sie nach links oder rechts ... Wie ging das zu? Entweder wählten die Fahrer genau die Richtung, die er ihnen angab, das heisst sie gehorchten ihm, oder es verhielt sich so, dass er genau wusste, wohin sie fahren mussten.
Die Wohnung der Tante kannte ich, auch den Blick zum Stubenfenster hinaus – Dächer und Kamine, irgendwo eine grosse Kuppel, in der Nähe ein Kirchturm, der ganz schief stand, weit unten der See, einige Segelschiffchen. Doch was mir in diesem Haus am besten gefiel, war die Toilette, ein längliches Lokal, an dessen Türe ein farbiger Karton hing; man sah darauf einen sommersprossigen Spitzbuben mit einer Zahnlücke, der mir kameradschaftlich zugrinste.
Bevor wir uns verabschiedeten, musste ich der Tante zuliebe immer ein bestimmtes Lied singen, das ihr, wie sie sagte, so gut gefiel. Manchmal, vor allem wenn noch andere Leute da waren, sträubte ich mich dagegen. Dann liess man mich im Nebenzimmer singen, während die Türe einen Spalt offen blieb.
Abends, auf dem Weg zum Bahnhof, fragte ich mich, ob wir nochmals das Fräulein mit dem Maskengesicht treffen würden. Es reizte mich, sie noch einmal zu sehen. Doch als wir an jener Stelle vorbeikamen, war das Bänkchen verlassen.
Einmal war Mutter ohne mich verreist. Vater war auch nicht da, wir Kinder allein zu Hause. Es dunkelte schon, als Betta von der Terrasse hereinrief, wir sollten schnell herauskommen. Mutter hatte dort ihre Blumen, unter anderem einen Kaktus, der soeben zu blühen begann. Aus der dornigen Schale entliess er eine herrliche weisse Blüte, auf die Mutter jahrelang gewartet hatte. Nun war sie da. Wenn man genau hinschaute, glaubte man, sie langsam wachsen zu sehen – eine füllige Dolde, zuerst noch aufgerichtet, dann durch das eigene Gewicht sich neigend.
Wir staunten über dieses Weiss, das wie Schnee im Dunkel schimmerte. «Wie schade, dass Mama nicht zu Hause ist», meinte Betta. «Sollte man nicht zum Nachbarn gehen und nach Zürich anrufen, damit sie es wenigstens weiss?» – «Das hat keinen Sinn», sagte Adrian. «Wenn sie es weiss, kann sie die ganze Nacht nicht schlafen.» Hierauf Thom: «Aber morgen kommt sie nach Hause, dann sieht sie’s.» – «Ja, dann sieht sie’s», sagte Adrian, «aber morgen ist sie wahrscheinlich schon verblüht – was so schön ist, dauert nicht lange.»
Leider stimmte es. Als Mama am nächsten Tag heimkam, war die Blüte schon halb verwelkt, ihr Zauber dahin, das Weiss gelblich verfärbt. Mutter war sichtlich enttäuscht. Sie schaute, kehrte in die Küche zurück, ging später nochmals hinaus: «Vielleicht hättet ihr den Kaktus in den Flur tun sollen, wo es kühl und schattig ist. Die Sonne hat ihm nicht gut getan.» Betta tröstete sie: «Aber der wird sicher wieder einmal blühen.» – «Ja, ja, aber das dauert wieder Jahre, und wer weiss, ob wir dann noch da sind.»
Ich war sechsjährig (wir wohnten damals schon in Zernez), als ich zu stehlen begann. Ich stahl Geld, sonst nichts, nur Geld, und zwar aus Mamas Haushaltbörse. Diese befand sich in einer kleinen Schublade des Küchenbüffets. Ich nahm immer nur Kleingeld, weil ich vermutete, das falle weniger auf. Angefangen hatte ich mit einem Zehnrappenstück, für das ich im Laden bei Regi, knapp zwei Minuten von uns entfernt, einige Zuckerplätzchen oder einen Schokoladestengel bekam. Später nahm ich dann mehr, zwei Zehnräppler, einen Zwanziger, dann einen Fünfziger, je nach Börseninhalt. Die Fünfziger waren kleiner als die Zwanziger, versteckten sich manchmal auch in den Falten des Beutels und schienen mir schon deshalb geeigneter zu sein. Als ich einmal in der Börse einen einzigen Zehner vorfand, liess ich ihn drin und kam mir dabei sehr klug vor. Am günstigsten war es, wenn Mutter gerade vom Laden kam und dort mit einem grösseren Geldschein bezahlt hatte. Ich sass dann in der Küche und schaute zu, wie sie Brot, Spaghetti, Kaffee, Konservenbüchsen auspackte, wobei der Geldbeutel eine Weile wie ein Kätzchen vor mir auf dem Tisch liegen blieb.
Ich erinnere mich, wie leicht mir das Stehlen fiel und wie der Reiz zunahm. Es war der intensivste Reiz, den ich je erlebt hatte. Das geklaute Geld steckte ich jeweils in die Tasche, schlenderte vor mich hin pfeifend die Treppe hinunter und aus dem Haus, ging dann entweder zu Regi oder in die Bäckerei Füm, kaufte Schokolade, Makrönchen oder Mohrenköpfe, was ich dann in irgend einem verborgenen Winkel verspeiste.
Süssigkeiten waren das eine, der Diebstahl das andere, denn während ich stahl, dachte ich noch kaum an den Bäckerladen, da war das Klauen noch Selbstzweck. Mit leichtem Kitzel betrat ich die Küche, dann die Stube, ich rief: «Hallo, ist jemand da?» Wenn sich niemand meldete, näherte ich mich dem Büffet, öffnete die kleine Schublade, griff nach dem Geldbeutel, spürte die Berührung mit dem weichen Leder. Jetzt nahm ich gelegentlich auch Einfrankenstücke. Für einen Franken bekam man allerhand, oft reichte es sogar für eine der grossen Schokoladen und einige Makrönchen. Von bösem Gewissen war nicht die Rede, vielleicht war ich mir nicht einmal bewusst, etwas Böses zu begehen. Im Gegenteil, in einem Anflug von Generosität war ich dazu übergegangen, das Gekaufte jeweils mit ein paar Kameraden zu teilen. Ich merkte, dass sie mich schätzten. Wir vereinbarten einen stillen Ort, wo sie auf mich warteten, bis ich mit meinem Papiersack auftauchte. Es wurde nie gefragt, woher ich das Geld hätte, um die Sachen zu kaufen. Vielleicht ahnten sie es, sagten aber kein Wort.
Читать дальше