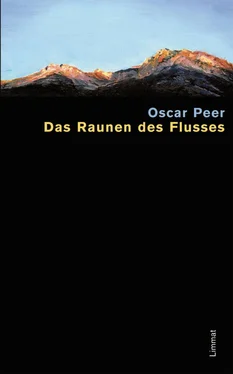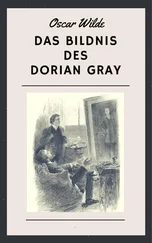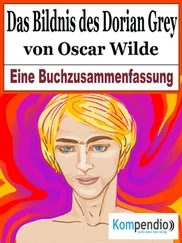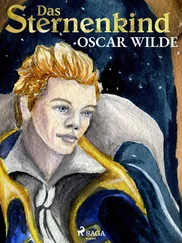Einmal hätte es mir schlecht ergehen können. Ich war mit zwei Kirschen aus Zuckerguss heimgekommen. Auch die bekam man bei Füm; sie waren gross, rot glasiert, hingen voll und appetitlich an einem zweigähnlichen Goldfaden, wie zwei richtige Kirschen, die mir schon ihrer Farbe und Grösse wegen gefielen. Ich hielt sie in der Hosentasche versteckt, ging auf die Terrasse hinaus, um sie dort in aller Stille zu geniessen. Ich zerriss den Goldzweig, steckte eine der beiden Früchte wieder in die Tasche, die andere in den Mund. Die Türe stand offen, doch niemand störte mich; ich begann zu lutschen, genoss die leckere Kugel in meinem Mund, zumal sie kompakt schien und nicht so bald zergehen würde. Doch eine Weile später, als sie kleiner geworden schien und ich sie schlucken wollte, blieb sie mir im Halse stecken; ich hatte mich verrechnet, brachte sie weder hinunter noch in den Mund zurück, konnte auf einmal nicht mehr atmen, schreien ging auch nicht; ich erstickte, stiess vermutlich nur stöhnende Laute hervor, schüttelte die Arme und stampfte mit den Füssen ... Ein Schutzengel kam mir zu Hilfe, genau im richtigen Moment wie alle Schutzengel, nämlich Frau Giamara, die Gattin unseres Hausvermieters, die zufällig einige Ferientage hier verbrachte. Sie erschien an der Terrassentüre, sah meinen grotesken Tanz, eilte heraus. Am Vorabend (das wurde mir erst später erzählt) hatten meine Eltern, die Frau Giamara sonst sehr schätzten, über sie gesprochen und sich dabei über ihre langen Fingernägel gewundert. Doch gerade diese kamen mir jetzt zugute: die Frau hielt mich mit dem linken Arm fest, steckte mir den Kleinfinger der Rechten in den Rachen, grübelte darin mit ihrem langen Fingernagel, bis es ihr gelang, die stecken gebliebene Kugel herauszuholen. Dabei rief sie laut nach meiner Mutter, und als diese herbei rannte, war ich bereits gerettet und konnte einen Schrei ausstossen. Später sagte man mir, ich sei schon ganz blau gewesen.
Merkwürdig übrigens, wie Frau Giamara die Zuckerkirsche in der flachen Hand hielt und fragte: «Was soll ich damit tun?» – «Wegwerfen!», sagte meine Mutter. Später, als ich allein war, warf ich auch die andere weg.
Leider kam mir diesmal der liebe Gott, den ich sonst in kritischen Situationen herbeirief, nicht in den Sinn, sonst hätte ich den Vorfall als Fingerzeig von oben deuten können. Stattdessen klaute ich weiter.
Mit der Zeit begann Mutter, die Dieberei zu bemerken, schien aber im Zweifel, welches ihrer Kinder dahinter steckte. Vielleicht dass sie mich, als ihren Jüngsten, vorerst ausschloss. Eines Abends bei Tisch sagte sie enttäuscht: «Heute ist mir schon wieder Geld gestohlen worden; ich frage mich, welches meiner Kinder ein Dieb ist.» – Betretenes Schweigen, man blickte sich um. Dann Betta, halb zornig weinend: «Also mich müsst ihr nicht anglotzen, ich habe noch nie gestohlen.» Hierauf Thom, die Ruhe in Person: «Ich auch nicht.» Adrian, damals schon Sekundarschüler, erklärte trocken: «Wenn jemand stiehlt, hat er das im Blut, dann ist ihm nicht zu helfen.» Vater fragte ihn: «Woher weisst du das? – Hast du es genommen? Zum Beispiel für Zigaretten?» Adrian war empört: «Für wen hältst du mich? Übrigens habe ich noch nie geraucht, wenn du es wissen willst!» Vater meinte: «Also wenn es niemand von euch war, dann ist es wahrscheinlich die Katze gewesen.»
Ich selber tat, als hätte ich kaum zugehört. Eine Weile herrschte Schweigen, doch als ich das Gesicht vom Teller hob, sah ich, dass alle Blicke auf mich gerichtet waren. Vor allem Vater musterte mich mit einer unheimlichen Miene. Ich weiss nicht, ob es mir gelang, Unschuld vorzutäuschen, jedenfalls passierte diesmal noch nichts.
Ich war entschlossen, nicht mehr zu stehlen. Nie wieder. Doch einige Tage später, da mich niemand zur Rede gestellt hatte und die Sache schon vergessen schien, tat ich es wieder. Es war Nachmittag, Mutter hatte erklärt, sie müsse zu einer Nachbarin. Ich hörte, wie sie die Treppe hinunterstieg, die Haustüre öffnete und wieder zumachte. Etwas später, als ich in der Küche die kleine Büffetschublade öffnete, vernahm ich ein Geräusch: sie beobachtete mich, ich sah ihr Gesicht im Türspalt.
Es folgte eine Gerichtsszene, nicht laut, aber schrecklich. Ich stand da, vermutlich mit kurzer Hose und Hosenträgern, sie sass nahe vor mir, schaute mir ins Gesicht: «Dann bist du es also? Mein jüngster Sohn, den ich am liebsten hatte, und der nun ein Dieb ist, ein richtiger Dieb, der seiner Mutter Geld stiehlt. Ich hätte nie gedacht, einen solchen Sohn zu haben. Wie konnte ich mich nur so täuschen ...» Ich weinte nicht, ich schwieg, verstand vielleicht erst jetzt, was ich getan hatte.
Für den Tag darauf war ein Ausflug des Kindergartens geplant. Doch daraus wurde nun nichts: «Morgen bleibst du zu Hause», sagte sie, «kommt gar nicht in Frage, dass du auf die Schulreise gehst. Wenn ich der tanta Maria (das war unsere geliebte Kindergärtnerin) erzählen würde, was du getan hast, würde sie dich gar nicht mehr sehen wollen. Jetzt gehst du sofort ins Bett, bevor die andern heimkommen, damit ich mich nicht für dich schämen muss.»
Ich ging ohne Widerrede, eilte ins Schlafzimmer hinauf, zog mich bis auf die Unterhose aus und schlüpfte ins Bett. Ich kam nicht mehr dazu, an das Vorgefallene zu denken, weil ich bald einschlummerte. Während der Nacht begann ich einmal im Schlaf zu weinen, erwachte aber erst, als ich merkte, dass Mutter neben mir im Bett lag. «Hör nur auf zu weinen», sagte sie, «das hat jetzt keinen Sinn.»
Am nächsten Morgen frühstückte ich allein. Als ich vom Schulplatz herüber Lärm hörte, ging ich ans Fenster, sah, wie sich die Gesellschaft dort besammelte, alle mit Rucksäckchen und Wanderausrüstung. Auch einige Mütter waren dabei. Später erschien tanta Maria, unser Zauberengel, ebenfalls mit Rucksack, auf dem Kopf ein hübsches grünes Hütchen. Man umgab sie von allen Seiten, sie reichte allen die Hand. Zuletzt sangen sie noch ein Lied, das wir eben gelernt hatten, dann zogen sie davon. Ich setzte mich wieder an den Tisch. Ich war hungrig, seit dem Vortag mittags hatte ich nichts mehr gegessen. Einmal kam Mutter herein, setzte sich an den Tisch, blätterte in der Zeitung, wortlos und ohne dass wir uns ins Gesicht schauten. Sie trank einen Schluck Kaffee, stand wieder auf und entfernte sich.
Um Bussebereitschaft zu demonstrieren, ging ich nach dem Frühstück wieder ins Bett, lag dort lange auf dem Rücken und verbrachte die Zeit damit, aus den Ästen und Maserungen in den Brettern der Zimmerdecke allerlei Gesichter und Fratzen herauszulesen, wobei ich sie mit Zuhilfenahme der Hände und mit Augenzukneifen verändern konnte. Eine Weile hielt ich die Augen geschlossen, sah dann im eigenen Innendunkel farbige Tupfen umherschweifen, versuchte auch, sie mit dem blossen Willen nach rechts oder nach links zu bewegen. Später holte ich vom Nachttisch der Eltern den grossen Wecker, spielte ein bisschen damit, liess ihn wiederholt klingeln, drehte die Zeiger nach vorn und nach hinten, zog ihn wieder auf, steckte ihn schliesslich unter mein Kissen, legte mich hin und horchte, wie er darunter tickte. Fast wäre ich dabei wieder eingeschlafen, doch da erschien Mutter, legte ein sauberes Hemd und saubere Hosen auf einen Stuhl, sagte, ich solle mich anziehen und dann sofort hinunterkommen. Als ich die Küche betrat, hatte sie meine hohen Schuhe geputzt, erklärte, wir würden jetzt gleich gehen; ich beeilte mich, die Schuhe anzuziehen und die Bändel festzuknüpfen, schweigend, während sie noch etwas in den Rucksack steckte. Man wusste, wo die Gesellschaft hingegangen war – es handelte sich um eine Bergterrasse mit einem kleinen See –, eine knappe Stunde vom Dorf entfernt.
Wir machten uns auf den Weg, ich trug den Rucksack. Es war unsere schweigsamste Wanderung. Wenn ich etwas sagte, antwortete sie kaum oder dann so einsilbig, dass ich bald wieder verstummte. Ziemlich erstaunt war ich dann über die fröhliche Art, wie sie oben, als wir den Ort erreichten, tanta Maria begrüsste und sich für unsere Verspätung entschuldigte. Ich hatte mich bald zu den andern gesellt und sprang mit ihnen umher. Etwas später bemerkte ich, wie sie irgendwo am Rande stand und mich beobachtete. Nachher entfernte sie sich, wanderte um den See herum, blieb irgendwo stehen und schaute eine Weile ins Wasser, ging dann weiter und verschwand beim Waldweg, wo wir heraufgekommen waren.
Читать дальше