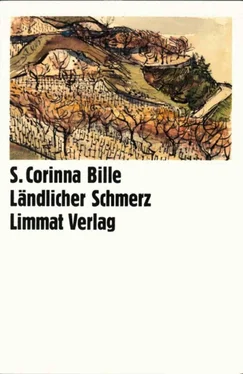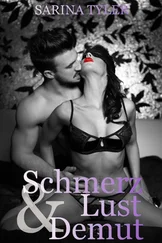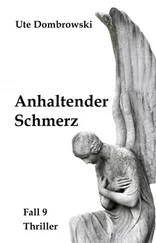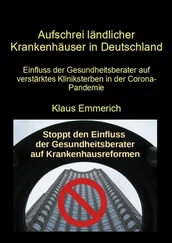Corinna Bille(1912–1979), schrieb zahlreiche Novellen und Romane (auf deutsch erschienen der Roman «Theoda» und der Erzählungsband «Schwarze Erdbeeren»). Sie war verheiratet mit dem Schriftsteller Maurice Chappaz.
«Corinna Bille entstammte einer der großartigsten europäischen Landschaften, dem Wallis, und obwohl sie leidenschaftlich gern reiste, blieb das Wallis ihr Lebensmittelpunkt, aus dem sie den ungeheuren Reichtum an Stoffen, Farben, Mythen und Menschen bezog, den ihr Schreiben auszeichnet. Corinna Bille war auch deshalb die Tochter dieses Landes, weil sie nicht nur stolz, stark, sehnsüchtig, träumerisch, innig und leidensfähig war, sondern eine Unbezähmbare.» Peter Hamm, Die Zeit
S. Corinna Bille
Ländlicher Schmerz
Erzählungen
Mit einem Nachwort von Anne Cuneo
Aus dem Französischen von Elisabeth Dütsch
Limmat Verlag
Zürich
Für meinen Vater
LÄNDLICHER SCHMERZ
Dennoch tötet jeder, was er liebt, und
alle sollen es wissen: Die einen tun es
mit einem hasserfüllten Blick, andere mit
zärtlichen Worten, der Feige mit einem
Kuss, der Tapfere mit einem Schwert!
Oscar Wilde
Ihre Augen waren kalt wie das Wasser und wechselten die Farbe wie das Wasser – je nach dem Grund, je nach dem Himmel … Sie hatte viel zu langes rotes Haar: Bis auf die Füsse fiel es ihr hinunter. Jeden Tag brauchte sie eine Stunde, um ihre Zöpfe zu flechten, aber sie weigerte sich, sie kürzer zu schneiden. Ihr Haarknoten sah nicht aus wie der von anderen Frauen; er war so gross und schwer, dass er den ganzen Nacken und den Ansatz der Schultern bedeckte. Sie hatte eine gerade Nase, reine Züge und eine so weisse Haut, dass sich jedermann darüber wunderte. Aber wer ihre schmalen, immer geschlossenen Lippen sah, bekam es mit der Angst zu tun.
So übermässig lang wie ihr Haar war auch das Goms, wo ihr Dorf lag. Ein ganz schwarzes Dorf, dessen Häuser sich dicht aneinanderdrängten und mit Eichhörnchenaugen auf einen Berg starrten, der auch ganz schwarz wurde, wenn das Wetter umschlug.
Als kleines Mädchen hatte man sie «Irrwisch» genannt; jetzt getraute man sich nicht mehr und sagte «Flavie», wie sie wirklich hiess. Aber auch jetzt noch wurde es heller, sobald sie die Dorfstrasse herunterkam.
Jeden Morgen ging sie zur Messe. Der Gemeindepriester schätzte sie hoch und führte sie als Beispiel an. Sie hatte fünf Brüder und zwei Schwestern. Der älteste Bruder war Missionar, der zweite Kartäuser, ein anderer Pfarrer im Unterwallis, der vierte Kapuziner, und der letzte studierte noch am Priesterseminar. Auch die beiden Schwestern waren geistlichen Standes. Die eine unterrichtete die Taubstummen im Kloster von Géronde, die andere lebte als Nonne im Kloster von Brig. Es hiess, Flavie habe sie alle dazu gedrängt, in einen Orden zu treten. Sie übte auf ihre Umgebung eine seltsame Macht aus. Es war eine solche Gewissheit in ihr, eine solche Willenskraft, gepaart mit einer grossen Sanftmut: Da blieb einem nichts anderes übrig, als sich zu fügen.
«Und sie? Warum ist denn sie nicht Nonne geworden?», erkundigten sich die unbequemen Frager. Die einen antworteten: «Das verbietet ihre zarte Gesundheit.» Die andern: «Es ist gut, wenn auch die Laien eine Heilige bei sich haben.» Die bösen Zungen gaben zu verstehen: «So fällt ihr die ganze Erbschaft zu.» Sie blieb also daheim bei ihren schon betagten Eltern. Der Vater und zwei Knechte kümmerten sich um die Güter und das Vieh; die Mutter ging manchmal noch mit aufs Feld hinaus. Im Übrigen besorgte sie die Küche. Flavie rührte kaum eine Arbeit an. Es wäre ihnen nicht in den Sinn gekommen, von ihr zu verlangen, dass sie auch Hand anlege. Erstaunlich bei Bauern: Sie begnügten sich mit Flavies Schönheit, ihrem Wissen, ihrer Tugend. Vielleicht erinnerten sie sich an die Geschichte von Maria und Martha.
An der Kirchweih tanzte sie nie. Sie war jedoch immer dabei, etwas abseits auf einer Anhöhe, von wo sie das Fest überblickte. Die jungen Leute hatten ihre Absagen satt und luden sie nicht mehr zum Tanzen ein. Um sie herum bildete sich eine Leere, als hätte sie einen Zauberkreis gezogen, und mitten drin stand sie unantastbar, sehr aufrecht, mit zusammengepressten Lippen.
Die Männer sahen trotzdem zu ihr hinüber; das konnte sie ihnen nicht verwehren. Merkte sie es überhaupt? … Während sie sich im Takte drehten, warfen sie ihr dann und wann einen fragenden Blick zu und vergassen darob ihre Tänzerinnen. Einer vor allem sah sie an. Ein unbeholfener Junge mit Augen voll Zärtlichkeit, Germain. Schon lange liebte er sie und sprach mit keinem darüber.
Am Anfang macht einen die Liebe glücklich, auch wenn sie fast hoffnungslos ist. Das brennt heiss in Blut und Seele. Man kennt sich kaum mehr aus: Die Berge haben eine andere Färbung, der Himmel auch, und das Dorf fängt an, dem Paradies zu gleichen, weil sie darin wohnt. Und jedes Mal wenn man ihr begegnet, ist es, als bekäme man ein schönes Bild geschenkt … Man verbirgt es sorgfältig im Herzen, um es später in aller Ruhe zu betrachten, wie man es in den Kindertagen mit den Bildchen machte, die einem ein herumziehender Kapuziner in die Hand drückte und auf denen Engel zu sehen waren mit glänzenden Flügeln und Heilige in goldenen Gewändern. Aber bald merkt man, dass diese Liebe zu tief mitten im Herzen steckt, als dass man sie noch herausreissen könnte; dann ist sie kein Glück mehr, sie wird zur Qual. «Ah, wenn ich sie haben könnte, diese Frau, alle Tage, alle Nächte, ganz für mich!» Und diese Qual gibt einem ungeahnten Mut.
An der Kirchweih im April erkühnte sich Germain, Flavie um eine Polka zu bitten. An den Sonntagen und Festen war sie noch unnahbarer als gewöhnlich. An solchen Tagen schienen alle Frauen des Dorfes grösser als sonst. Das machten ihre bebänderten Hüte aus – jeder ein kostbarer Turm –, die ihnen die Würde von Statuen verliehen.
Als die Dorfleute Germain auf Flavie zugehen sahen, waren sie höchst überrascht und gespannt; sogar die Musik fiel aus dem Takt. Die einen lachten: «Die bekommt er nicht.» Die andern bewunderten ihn: «Der hat wenigstens keine Angst vor ihr!» Justines Gesicht verdüsterte sich, denn Justine liebte Germain. Und als er mit Flavie zurückkam, staunten sie alle. Das Paar erklomm den Tanzboden. Die Musikanten hielten einen Augenblick inne, dann legten sie los. Flavie, die sonst nie tanzte, war in Germains Armen geschmeidiger als ein Lärchenzweig.
– Irrwisch, sagte einer laut.
Und die andern wiederholten: «Irrwisch!»
Zuerst war Germain ganz benommen, seine Augen wurden blind und seine Ohren taub … Er begriff nicht, wie er das hatte wagen können. Aber jetzt, da er sie festhielt, seine Liebste, stieg die Freude wieder in ihm auf und auch der Mut. Er fing an, sie beim Tanzen zu betrachten. Seine ausgehungerten Augen nahmen von ihr auf, so viel sie konnten. Noch nie hatte er sie so nahe gesehen. Er entdeckte mancherlei: auf ihren Wangen ein paar Sommersprossen, wie die ersten Sterne an einem noch hellen Himmel, in der Unterlippe einen kleinen Riss und im Kinn ein leichtes Grübchen. Und er sah, dass ihre Wimpern weder rot noch blond waren, sondern wie die winzigen Goldkörnchen, die manchmal im Rhonesand aufblitzen. Das gab ihrem Gesicht einen übernatürlichen Ausdruck. Den eines Engels oder den eines Dämons? Germain fragte sich das nicht.
*
Von diesem Tage an gingen sie jeden Sonntag miteinander spazieren. «Er hat es fertiggebracht, sie zu zähmen», stellten die Leute fest. Aber mit der Hochzeit eilte es ihr nicht. Sie konnte sich nicht entschliessen und fand tausend Vorwände, um den Tag hinauszuschieben. Germain wurde ungeduldig: Er hatte so lange auf sie gewartet!
Читать дальше