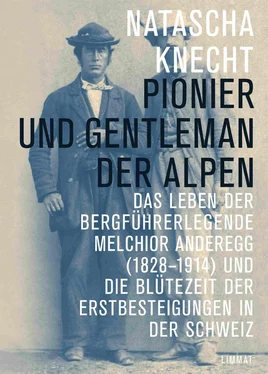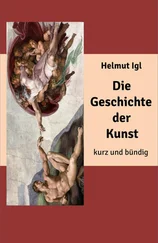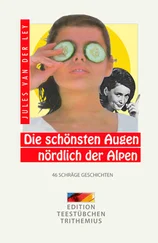Alle bleiben und sie errichten mit Steinen eine Lagerstätte, laben sich mit Wasser und Kirschwasser, Brot, Fleisch und Käse. Zum Schlafen legen sich die älteren wie Löffel ineinander. Die Jungen hingegen, vor Angst zu erfrieren, tanzen und lärmen bis nach Mitternacht. Das Thermometer sinkt «auf vier volle Grad über Eis.» Am nächsten Morgen um 4 Uhr befiehlt Rohrdorf seinen Leuten, aufzubrechen «und eine Probe zu machen, wie weit man auf die Jungfrau Vordringen könne». Er selber macht keine Anstalten mitzugehen, bleibt mit Roth zurück, trinkt Wasser mit Wermuth-Extrakt auf deren Gesundheit und zeichnet dilettantisch die Jungfrau ab. Bald darauf kehren die anderen zurück und erzählen, dass sie auf dem Rottalsattel umgekehrt wären, weil sie «von dem Winde so ergriffen worden, dass es unmöglich gewesen sey, weiter fortzukommen.» Noch ein anderer Umstand habe sie zurückgetrieben, meint Rohrdorf: «Nämlich die Besorgnis, dass sie nicht mehr in die Höhle zurückkehren möchten und noch einmal auf dem Gletscher übernachten müssten.»
Zurück im Flachland gibt er Christian Roth einen Geldvorschuss und den Auftrag, noch andere Männer von Lauterbrunnen zu engagieren. Rohrdorf will die Jungfrautour wiederholen. Aber Roth hat Eigenes im Sinn: Mit Rohrdorfs Geld engagiert er sechs Grindelwaldner und führt die Besteigung eigenmächtig durch – ohne Rohrdorf zu benachrichtigen. Selber erreicht Roth den Gipfel nicht, aber die anderen. Sie pflanzen Rohrdorfs 36 Pfund schwere Fahne und behaupten, keine Anzeichen eines früheren Besuchs aufgefunden zu haben. Für diese Besteigung erhalten sie von der Kantonsregierung, welche damals noch Pioniere mit Vorbildcharakter belohnt, je einen Doppeldukaten Prämie.
DIE ERSTE HOCHALPINE KATASTROPHE
Einzig am Mont Blanc, dem höchsten Alpengipfel, bleibt in diesen Jahren das Interesse konstant. Von 1787 bis 1850 wird dieser vergletscherte Riese rund fünfzigmal bestiegen. 1820 ereignet sich hier auch der erste hochalpine Unfall überhaupt. Der russische Wissenschaftler Dr. Joseph Hamel lässt einen Käfig voller Brieftauben hochschleppen, um zu testen, ob diese in der verdünnten Luft fliegen können. Bei diesem weltbewegenden Experiment begleiten ihn ein Genfer Ingenieur und zwei Engländer der Universität Oxford. Unterhalb des Gipfels geraten sie in eine Lawine. Drei der zwölf Führer sterben. Die Tragödie wirkt einerseits abschreckend, andererseits bewirkt sie, dass die Besteigung noch prestigeträchtiger wird. «Sind Sie auf dem Berg gewesen?», sei in Chamonix eine notorische Frage geworden, berichtet ein Engländer. Die Antwort habe über das generelle Ansehen des Gefragten entschieden. Besonders bei den ausländischen Damen.
1838 steigt die französische Comtesse Henriette d’Angeville auf den höchsten Alpengipfel. Nachdem das erste «Frauenzimmer» auf dem Mont Blanc, Marie Paradies, 1808 ab dem Grand Plateau getragen und am Seil gezogen worden ist, will sie die Anstrengungen bis zuoberst aus eigener Körperkraft bewältigen und lässt sich dafür «Mannskleider» anfertigen – weite Hosen, die sie unter einem langen Mantel trägt und erst am Berg anzieht, damit sie Chamonix noch in betont femininer Kleidung verlassen kann. Im Gepäck hat sie Kölnischwasser, einen Fächer, einen Schuhlöffel, Thermometer und Fernglas, sowie einen Spiegel, um die Gesichtshaut auf Sonnenbrand hin zu kontrollieren, damit rechtzeitig Gurkencreme zur Kühlung aufgetragen werden kann. Beim Aufstieg kommt sie an die Grenzen ihrer Kräfte. Eine «unwiderstehliche Müdigkeit» zwingt sie zu einer kurzen Schlafpause. Den Gipfel schafft sie dennoch. Dort soll sie sich auf die Schultern ihrer Führer gesetzt haben, damit sie eineinhalb Meter höher gewesen sei als alle vor ihr.
Der grosse Mont Blanc bleibt ein Magnet. Rundum und im restlichen Hochalpenraum bleibt es dagegen noch immer relativ still. In dieser Zeit beginnen die ersten Schweizer Bergsteiger ihre Freizeit regelmässig in der Höhe zu verbringen. Unter ihnen etwa der Berner Gottlieb Studer, der Zürcher Theologe Melchior Ulrich, der Sankt Galler Textilhändler Jakob Weilenmann oder der Churer Forstingenieur und Gebirgstopograf Johan Coaz, der zwischen 1845 und 1850 im Bündnerland achtzehn Gipfel besteigt, darunter den 4049 Meter hohen Piz Bernina. Ihre Bergfahrten haben jedoch noch keinen Wettkampfcharakter und dienen nach wie vor dazu, für die Nachwelt nützliche Kenntnisse heimzubringen.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.