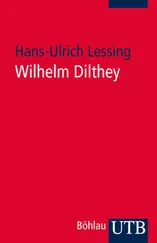2. Schriftliche Quellen
Mündliche Quellen genügen nicht
Gemeinsame Quelle(n)?
Literarische Abhängigkeit?
Wenn man sich von diesen Übereinstimmungen der drei Synoptiker ein Bild machen will, sollte man einmal die Perikopen Mk 1,40–45; 8,34–9,1; 11,27–33; 13,5–8 mit den Parallelen bei Matthäus und Lukas in einer dieser Synopsen vergleichen. (Dass dieser Vergleich wissenschaftlich natürlich nur am griechischen Originaltext vollzogen werden kann, sei wenigstens angemerkt. Aber einen Überblick kann man sich auch mit einem Blick in eine dafür geeignete deutsche Synopse verschaffen.) Die Übereinstimmungen in diesen Perikopen sind so stark, dass sie kaum aufgrund der gemeinsamen Teilhabe an der einen mündlichen Tradition entstanden sein können, obwohl man auch das in der Auslegungsgeschichte vermutet hat. Sie müssen vielmehr nach allem, was wir wissen, auf schriftlichem Wege entstanden sein. Als Möglichkeiten bieten sich zwei Alternativen an: Nach der ersten hätten die Evangelisten entweder auf eine gemeinsame Quelle oder auf mehrere gemeinsame Quellen zurückgegriffen. Wegen des gemeinsamen Rahmens müsste wenigstens eine dieser Quellen schon einen den heutigen Evangelien ähnlichen Charakter getragen haben. Oder aber, so die zweite Alternative, die Evangelisten hätten in Kenntnis zumindest eines der drei Evangelien ihr Werk verfasst, sie wären also in einer noch näher zu erarbeitenden Weise voneinander abhängig.
3. Das synoptische Problem in der Alten Kirche
Die Tatsache, dass sich die ersten drei Evangelien in vielem sehr ähnlich sind, ist schon früh erkannt worden, ebenso, dass es neben diesen Übereinstimmungen auch Unterschiede und sogar Widersprüche gibt. So heißt es z. B. bei Johannes Chrysostomus (349/354–407):
Johannes Chrysostomus
„Hätte es nicht genügt, wenn ein einziger Evangelist alles berichtet hätte? Ja, es hätte genügt; aber auch wenn es vier sind, die geschrieben haben, so schrieben sie weder zur gleichen Zeit noch am gleichen Ort, und sie kamen auch nicht zusammen, um sich untereinander abzusprechen; daher ist es der beste Beweis für die Wahrheit, wenn sie wie aus einem Mund sprechen. Aber, so heißt es, gerade das Gegenteil trifft doch zu; denn oftmals wird aufgedeckt, dass sie einander widersprechen. Aber auch dies ist ein sehr großer Erweis der Wahrheit. Denn wenn sie ganz genau übereinstimmen würden, und zwar bis in die Orts- und Zeitangaben und in den Wortlaut hinein, dann würde kein Gegner glauben, dass sie das, was sie schrieben, nicht nach menschlicher Absprache geschrieben haben; denn eine so weitgehende Übereinstimmung sei kein Zeichen von Ehrlichkeit. So aber befreit sie mehr der scheinbare Widerspruch in geringfügigen Punkten von jedem Misstrauen… Wenn sie aber im Hinblick auf Zeit- oder Ortsangaben widersprüchlich berichtet haben, dann beeinträchtigt dies die Wahrheit ihrer Ausführungen überhaupt nicht“ (Hom. in Matth. I 2–4 in der Übersetzung von H. Merkel, [Pluralität 139]).
Augustinus
Augustinus (354- –430) war der erste, der sich Gedanken über schriftstellerische Beziehungen zwischen den Evangelien machte. Nach seiner Meinung sind die Evangelien in der Reihenfolge abgefasst, wie sie heute im Neuen Testament stehen, und die jeweils späteren Evangelien sind in Kenntnis der früheren abgefasst worden. Das schließt eine eigenständige Gestaltung des jeweiligen Werkes durch den betreffenden Evangelisten allerdings nach Ansicht des Bischofs von Hippo nicht aus. Das Matthäusevangelium wäre danach also das älteste Evangelium. Die Tatsache, dass das Werk des Markus trotz seiner Benutzung des ersten Evangeliums als Vorlage wesentlich kürzer als dieses ist, wird von Augustinus auch bereits reflektiert und damit erklärt, dass Markus ein Exzerpt seiner Vorlage angefertigt hat. Allerdings könnten diese Ansichten Augustins leicht missverstanden werden. Er hält die Evangelisten trotz dieser Äußerungen sicher nicht für selbständige Schriftsteller, denn er schreibt:
„quidquid enim ille [sc. Christus] de suis factis et dictis nos legere voluit, hoc scribendum illis [sc. evangelistis] tamquam suis manibus imperavit.“ „Denn was auch immer jener [sc. Christus] über seine Taten und Werke uns lesen lassen wollte, das ließ er von ihnen [sc. den Evangelisten] gleichsam wie von seinen eigenen Händen niederschreiben.“ (De cons. ev. I 35,54)
Die modernen Hypothesen über die Entstehung und die Abhängigkeitsverhältnisse der Evangelien sind aber nicht einfach als eine Fortsetzung der augustinischen Überlegungen anzusehen.
4. Der literarische Befund II
Übereinstimmungen zwischen Mt und Lk
Allerdings ist mit den oben erwähnten Übereinstimmungen zwischen allen drei Synoptikern der Tatbestand der vorhandenen Ähnlichkeiten noch nicht genügend beschrieben, denn neben diesen Übereinstimmungen zwischen allen drei Synoptikern gibt es auch noch ganz starke, wörtliche Übereinstimmungen über längere Passagen ausschließlich zwischen den Werken des Matthäus und Lukas – zu diesen Abschnitten findet sich also bei Markus keine Parallele. Man kann sich einen Überblick über diese Ähnlichkeiten verschaffen, indem man Mt 3,7–10; 7,7–11; 11,4–11; 24,45–51 mit der jeweiligen Lukasparallele in einer Synopse vergleicht.
Der doppelte Tatbestand
Der Tatbestand, dessen Entstehung jede Erklärung der sog. synoptischen Frage zum Verständnis bringen muss, ist also ein doppelter: einmal die Ähnlichkeit zwischen allen drei Synoptikern, zum anderen die engen Übereinstimmungen zwischen dem Matthäus- und dem Lukasevangelium.
Betrachtet man die Übereinstimmungen aller drei Synoptiker etwas näher, so fällt auf, dass das Markusevangelium immer in der Mitte zwischen dem Matthäus- und dem Lukasevangelium steht, das bedeutet: fast der gesamte Bestand des Markusevangeliums findet sich entweder im Matthäus- und im Lukasevangelium oder in einem von beiden: Das Matthäusevangelium bietet 90 % und das des Lukas 55 % des Markusstoffes.
Markinisches „Sondergut“
Statistische Betrachtung
Reihenfolge der Perikopen
Nur drei Perikopen (Mk 4,26–29 Das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat; 7,31–37 Die Heilung eines Taubstummen; 8,22–26 Die Heilung des Blinden von Bethsaida) und drei kurze Texte (Mk 3,20 f. Jesu Verwandte halten ihn für verrückt; 9,49 Das Salzen mit Feuer; 14,51 f. Das Fliehen des Jünglings) finden sich in keinem von beiden.
Nach Versen gezählt bedeutet das: Von den 609 Versen des Markusevangeliums haben nur ca. 30 kein Äquivalent bei den beiden ► Seitenreferenten. Oder bezogen auf die Wörter: Von den 11 078 Wörtern des Markus begegnen bei Matthäus 8555, bei Lukas 6737. Nach einer etwas anderen Zählung der gemeinsamen Abschnitte benutzt Matthäus 7678 und Lukas 7040 Wörter von den 10 650 des Markusevangeliums, oder bezogen auf die Reihenfolge der Perikopen: Die Evangelien des Matthäus und Lukas stimmen in der Reihenfolge immer dann überein, wenn sie mit Markus übereinstimmen. Wenn sie von Markus in der Reihenfolge abweichen, stimmen sie auch untereinander nicht überein. Die Abweichungen beziehen sich im übrigen nur auf die erste Hälfte des Markusevangeliums, denn ab Mk 6,7 gibt es zwischen dem Evangelium des Matthäus, dem des Markus und dem des Lukas in der Reihenfolge praktisch keine Abweichungen. Zwar gibt es vor allem im Werk des Lukas erhebliche Auslassungen von Markus-Stoff (Mk 6,45–8,26 = sog. große Lücke) und auch große Einschübe (Lk 9,51–18,14 = sog. große Einschaltung, ohne Parallelen bei Markus oder Matthäus), aber diese Einschübe oder Auslassungen haben keine Umstellungen von Markus-Stoff zur Folge, wie man sich an den Perikopen-Übersichten in den Synopsen leicht verdeutlichen kann (vgl. z. B. Vollständige Synopse der Evangelien, 303 ff.). Insgesamt weicht das Matthäusevangelium überhaupt nur in 12 Fällen von der Reihenfolge des Markus ab, und auch bei Lukas liegen nur ganz wenige Abweichungen von der Markus-Reihenfolge vor: Die Reihenfolge von Mk 3,7–12 und 3,13–19 ist bei Lukas vertauscht, die Berufung der Zwölf, die bei Markus auf den Sammelbericht von den Heilungen folgt, geht diesem bei Lukas voraus. Ebenso verfährt Lukas mit der Geschichte von Jesu Verwandten (Mk 3,31–34). Diese geht bei Lukas nicht wie bei Markus dem Gleichniskapitel (Mk 4,1–25) voran, sondern folgt diesem. In 4,41 hat Lukas Mk 1,34 und 3,11 f. miteinander verbunden. Bei den Perikopen Mk 1,16–20 (vgl. Lk 5,1–11) und 6,1–6 (vgl. Lk 4,16–30) dürfte es sich dagegen nicht um eine Änderung der Reihenfolge handeln, da Lukas hier einer anderen Tradition folgt.
Читать дальше
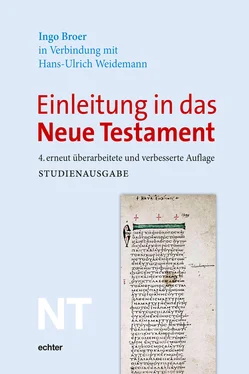
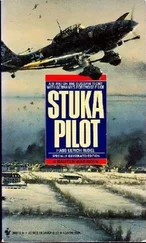


![Felix Sobotta - Das alte Jagdschloss und das neue Haus [Band 1]](/books/493473/felix-sobotta-das-alte-jagdschloss-und-das-neue-ha-thumb.webp)