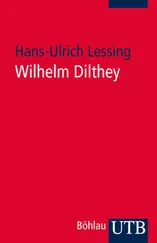1 ...7 8 9 11 12 13 ...54 2.3.1 Die Evangelien als Midraschim
Die Einordnung der Evangelien als Midraschim kommt m. E. nicht in Frage, da dieser (nicht besonders klare) Begriff in der Regel durch das Charakteristikum der Schriftauslegung gekennzeichnet ist. In den Evangelien begegnet zwar Schriftauslegung, aber diese vermag doch nicht die Evangelien insgesamt zu charakterisieren. Darüber hinaus ist das Verhältnis zur Heiligen Schrift des Alten Bundes z. B. bei Markus und Matthäus durchaus unterschiedlich, so dass sich diese Bezeichnung als Gattungsbegriff für beide Werke kaum eignet.
2.3.2 Die Evangelien als Ideal-Biographie
Die These und die Einwände dagegen
Die von K. Baltzer behauptete Übertragung der alttestamentlichen Ideal-Biographie auf Jesus durch Markus wird damit begründet, dass die für diese Gattung im Alten Testament konstitutiven Züge auch im Markusevangelium zu finden sind. Wenn die zu dieser Gattung gehörenden alttestamentlichen Stücke aufgrund ihrer heutigen Eingliederung in größere Kontexte auch nur mit Schwierigkeiten zu erheben sind, so lassen sich doch noch deren Gattungscharakteristika erkennen. Dazu gehören der Einsetzungsbericht, durch den der Prophet / König in seinem Amt legitimiert wird, und die mit diesem Amt verbundenen Funktionen, z. B. Sicherung des Friedens, Herstellung der sozialen Gerechtigkeit und Einsatz für einen reinen Kult. Diese Charakteristika sind variabel und müssen nicht in allen Exemplaren der Gattung realisiert sein. Baltzer findet sie auch im Markusevangelium, wobei der Einsatz mit der Taufe und nicht mit der Geburt für ihn ein besonders deutliches Zeichen ist, das in Richtung Propheten-Biographie weist. Aber auch der Einsatz für einen reinen Tempelkult, die Kritik an den Interpretationen der Gesetze, die Verkündigung von Gottesherrschaft und Gericht sowie das Leiden weisen in die gleiche Richtung. – Gegen diese Annäherung von Markusevangelium und Propheten-Biographie sind eine ganze Reihe von Einwänden vorgebracht worden, z. B. dass die für das Markusevangelium besonders charakteristischen, weil häufig mit Hilfe der durchbrochenen Schweigegebote betonten Wunder in der Propheten-Biographie nur im Elia-Elischa-Zyklus vorkommen (vgl. 1 Kön 17,17–23; 19,1–13; 2 Kön 2–8), dass die markinischen Berichte vom Leiden Jesu sich wesentlich stärker an das Schema vom leidenden Gerechten anlehnen und dass Tod und Begräbnis ebenso nur schwach in der Propheten-Biographie verankert sind. Mag man über diese Differenzen noch hinwegkommen, müsste doch, wenn die Idealbiographie eines Propheten die Darstellung Jesu im Markusevangelium wirklich prägen würde, der Propheten-Titel wenigstens leicht hervorgehoben werden. Gerade das aber ist nicht der Fall. Die Übertragung des Propheten-Titels auf Jesus wird in Mk 6,15 f. und 8,27–30 gerade abgelehnt. Kommt von daher die Propheten-Biographie als Vorbild-Gattung für das Markusevangelium nicht in Frage, so ist die Übertragung der Motivreihe vom leidenden Gerechten auf das markinische Werk zu prüfen.
2.3.3 Das Markusevangelium als Biographie des Gerechten
Das Motiv vom leidenden Gerechten prägt nicht das ganze Evangelium
Nach dieser von D. Lührmann erarbeiteten These hat Markus das Motiv des leidenden Gerechten aus Weish 2,12–20; 5,1 ff. entnommen und nicht nur auf die Passionsgeschichte, sondern auf das ganze Werk übertragen. Deswegen hat Lührmann das Werk des Markus „Biographie des Gerechten als Evangelium“ genannt. Der Leser finde im Markusevangelium die typische Geschichte des Gerechten und erhalte damit die Möglichkeit, sich selbst im Schicksal Jesu wiederzufinden. – Der Einfluss des Motivs vom leidenden Gerechten auf die Passionsgeschichte ist unbestritten, dass dieses Motiv eine spezielle Gattung konstituiert, ist dagegen kaum wahrscheinlich zu machen. Darüber hinaus ist es als Motiv keineswegs für das ganze Evangelium leitend, wie man u. a. daran sehen kann, dass die markinische Christologie nicht ausschließlich durch Niedrigkeitsmotive, sondern auch durch Hoheitstitel gekennzeichnet ist.
2.3.4 Ableitungen der Gattung Evangelium aus griechisch-hellenistischer Literatur
2.3.4.1 Die Evangelien als Aretalogien
Keine Gattung „Aretalogie“ in der Antike
Mit diesem Terminus werden seit dem vierten Jahrhundert n. Chr. biographische Berichte mit moralischer Abzweckung bezeichnet, die mit zahlreichen Wundern des jeweiligen göttlichen Menschen oder des jeweiligen Gottes ausgeschmückt sind (von griechisch aretai; dieses Wort hat aber viele Bedeutungen, es kann neben den Wundern nicht nur die Tugend / Tüchtigkeit, sondern auch die Offenbarung / Erscheinung eines Gottes bezeichnen). Als charakteristisches Beispiel wird meist auf die von ► Philostrat im dritten Jahrhundert n. Chr. verfasste Vita des ► Apollonius von Tyana hingewiesen, die sich aber in dem Charakter einer Aretalogie nicht erschöpft, sondern auch biographische Züge aufweist. Dass es in der Antike die Bezeichnung „Aretaloge“ u. a. für die Deuter von Träumen und Visionen gegeben hat, ist unbestritten, jedoch ist im Altertum der Terminus Aretalogie im hier gebrauchten Sinn nicht bekannt. Die Arete (Tugend) konstituiert auch nicht eine eigene Gattung, sondern kann in vielen Gattungen gepriesen werden (z. B in Hymnen und im Roman). Die Idee, das Markusevangelium so zu klassifizieren, hängt u. a. mit der Annahme zusammen, dass eine der johanneischen Zeichenquelle (s. dazu unten § 9 Nr. 3.2) ähnliche Sammlung von Wundergeschichten dem Markusevangelisten als Quelle vorlag, deren Verbindung mit der Passionsgeschichte dann zur Form des Evangeliums führte. Da es bei den Griechen eine solche Gattung nicht gegeben hat, kann sie auch nicht als Vorbild für Markus angesehen werden. Darüber hinaus sind die Übergänge zwischen Aretalogie und Biographie fließend, da das Werk des ► Philostrat auch zu den Biographien gerechnet worden ist.
2.3.4.2 Die antike Tragödie und Tragikomödie und die Evangelien
Aufgrund des tragischen Ausgangs Jesu in den Evangelien hat man diese auch mit der antiken Tragödie verglichen bzw., weil das tragische Ende bei Jesus nicht das letzte Wort ist, mit der Tragikomödie. Im Grunde wird nach dieser letzteren Ansicht das Schicksal Jesu im Markusevangelium sowohl aus der Perspektive der Tragödie als auch aus der der Komödie betrachtet. Gegen diese Einordnung des Markusevangeliums ist geltend gemacht worden, dass nach der aristotelischen Poetik nicht die Tragödie mit ihrer schauspielerischen Darstellung, sondern allenfalls das Epos mit der Ausdrucksform der Erzählung als Parallele in Frage kommt. Für beide aber verlangt Aristoteles die Versform (vgl. Poetik 1 f.). Außerdem widerspricht der episodale Charakter des Evangeliums dieser Zuordnung.
2.3.4.3 Der antike Roman und die Evangelien
Der antike Roman als Gattung
Der Roman ist in der griechischen und römischen Literatur eine relativ spät auftauchende Gattung, die sich ab dem dritten Jahrhundert v. Chr. zunächst in der Gestalt des utopischen Reiseromans und später vor allem als Abenteuer- und Liebesroman ausbildete. Eine literarische Theorie für den Roman hat die Antike noch nicht entwickelt, allerdings gibt es Ansätze dazu bei Macrobius (um 400 n. Chr.) und Julian Apostata (Kaiser von 361–363 n. Chr.). Ersterer sieht Roman und Komödie zusammen und bezeichnet sie als Erdichtungen (fabulae), die dem Vergnügen und dem Genuss dienen sollen, weswegen er diese Gattung aus seiner Sicht als Neuplatoniker auch ablehnt. Julian sieht den Roman ebenfalls durch den fiktiven Charakter gekennzeichnet, und auch er lehnt ihn ab, weil diese Liebeserzählungen nach seiner Ansicht nur Begierden erwecken. Mit der Erkenntnis des fiktiven Charakters haben diese antiken Autoren bereits ein wichtiges Strukturelement des Romans erkannt. In neuerer Zeit wurden an Elementen, die die Gattung Roman in der Antike konstituieren, vorgeschlagen: der fiktionale Charakter der Erzählung vorwiegend in Prosa; die Bestimmung zum (Vor-)Lesen, also nicht zum Deklamieren; die leserfreundliche Form mit kunstvollen Strukturen; ein Sujet fast immer von nichtmythischem Charakter; nur lockere Bindung an die objektive Realität; teilweise fingierte Realität, oft mit illusionistischem Charakter, als Gegenbild zur Realität (Kuch 22 f.).
Читать дальше
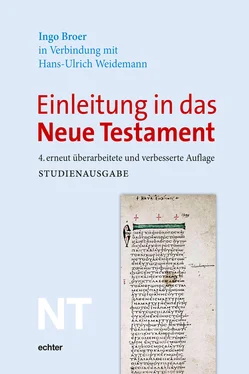
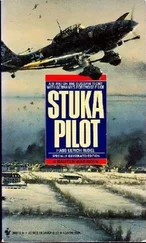


![Felix Sobotta - Das alte Jagdschloss und das neue Haus [Band 1]](/books/493473/felix-sobotta-das-alte-jagdschloss-und-das-neue-ha-thumb.webp)