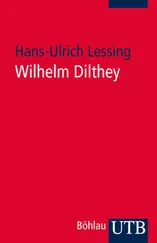„Einig war man sich in dem Urteil, dass die Historie Jesu für den Glauben konstitutiv sei, weil der irdische und der erhöhte Herr identisch sind. Der Osterglaube hat das christliche ► Kerygma begründet, aber er hat ihm seinen Inhalt nicht erst und ausschließlich gegeben“ (203).
„Denn wenn die Urchristenheit den erniedrigten mit dem erhöhten Herrn identifiziert, so bekundet sie damit zwar, dass sie nicht fähig ist, bei der Darstellung seiner Geschichte von ihrem Glauben zu abstrahieren. Gleichzeitig bekundet sie jedoch damit, dass sie nicht willens ist, einen ► Mythos an die Stelle der Geschichte, ein Himmelswesen an die Stelle des Nazareners treten zu lassen … Offensichtlich ist sie der Meinung, dass man den irdischen Jesus nicht anders als von Ostern her und also in seiner Würde als Herr der Gemeinde verstehen kann und dass man umgekehrt Ostern nicht adäquat zu begreifen vermag, wenn man vom irdischen Jesus absieht“ (196).
Hier wird die theologiegeschichtliche Bedeutung der markinischen Idee genügend deutlich. Denn ob wir ohne ihn Evangelien im Sinne der Werke der vier Evangelisten hätten, ist keineswegs ausgemacht. Lukas nennt nicht zu Unrecht die Vorgängerwerke in seinem Vorwort. Die Bedeutung der Tatsache, dass und wie Markus als erster den Weg der Integration der Jesusworte und -erzählungen in das Evangelium gegangen ist und damit zum Wegbereiter für seine Nachfolger wurde, ist nicht leicht zu überschätzen.
Die Bezeichnung der vier Evangelien als solche ist nicht der älteste Sprachgebrauch, vielmehr bezeichnet das Wort Evangelium bei Paulus die Heilspredigt vom Christusereignis und zusammenfassende Formeln der wichtigsten Heilsereignisse (1 Kor 15,3–7; Röm 1,1–4). Markus hat als erster, indem er diesen Begriff auf sein Werk angewendet hat, das Leben Jesu in das Evangelium integriert, und die übrigen drei Evangelisten sind ihm darin gefolgt, auch wenn Lukas und Johannes den Begriff nicht verwenden. Die neutestamentliche Verwendung des Begriffs lässt sich einlinig weder aus dem Alten Testament noch aus dem heidnischen ► Kaiserkult ableiten, beide könnten jedoch durchaus die Christen bei der Anwendung dieses Begriffes beeinflusst haben.
2. Die literarische Gattung Evangelium und ihre Wurzeln
Die Frage nach der Pilotfunktion des Markus stellt sich aber auch noch in anderer Richtung. Hat er nicht nur als erster das Leben Jesu in das Evangelium und damit in das ► Kerygma integriert, sondern daneben auch noch eine ganz neue literarische Gattung, eben die des Evangeliums, geschaffen, oder kann er sich bei seinem Werk an andere Werke der Antike anlehnen und deren literarische Gattung übernehmen?
2.1 Übereinstimmungen und Differenzen zwischen den vier Evangelien und die Gattung „Evangelium“
Einheitliche Literaturgattung?
Die Evangelien weisen untereinander zweifellos neben den noch zu nennenden Übereinstimmungen auch eine Reihe von Unterschieden auf. So überliefern Matthäus und Lukas eine sog. Kindheitsgeschichte, Markus und Johannes dagegen nicht. Lukas beginnt mit einem für damalige Verfasser typischen Vorwort mit deutlichen literarischen Ambitionen, das wiederum die anderen Evangelisten so nicht kennen, während Johannes sein Werk mit dem Prolog beginnt, zu dem es in den synoptischen Evangelien keine Parallel-Überlieferung gibt. Angesichts dieser Differenzen im Stoff ist die Frage berechtigt, ob es überhaupt sinnvoll ist, von einer einheitlichen Literaturgattung zu sprechen und ihr alle vier Evangelien zuzuweisen.
Freilich gehört zu einer Nennung der Unterschiede auch die Anführung der Übereinstimmungen: Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu mit der Taufe durch Johannes den Täufer, öffentliche Wirksamkeit in Galiläa (allerdings im vierten Evangelium immer wieder auch in Jerusalem), Wundererzählungen und Streitgespräche, Ende in Jerusalem und Auferstehung. Diese geben den Evangelien abgesehen von der einheitlichen Hauptperson ein so übereinstimmendes Gepräge, dass man diese doch wohl zu Recht einer einheitlichen Größe zuweisen kann, zumal sich diese Gemeinsamkeiten keineswegs nur auf das gemeinsame Thema / die gemeinsame Hauptperson und den gemeinsamen Rahmen (der im Johannesevangelium wenigstens dem der Synoptiker sehr ähnlich ist) beschränken.
Verwandtschaft im Formalen
Die Ähnlichkeit der Evangelien besteht keineswegs nur im Inhalt, sondern auch in den für die Gattungsbestimmung wichtigeren formalen Fragen: Alle vier Evangelien bestehen aus noch deutlich erkennbaren, ursprünglichen Einzelüberlieferungen – das gilt auch für das Johannesevangelium, wenn für dieses auch eindeutig nicht in gleichem Maße wie für die Synoptiker, da das Johannesevangelium im Gegensatz zu den letztgenannten auch größere Reden enthält, die nicht einfach aus hintereinander gestellten Einzelstücken bestehen (vgl. Joh 5,19–47; 14–17 z. B. mit Mt 5–7). D. h. alle vier Evangelien tragen wenigstens z. T. Perikopencharakter oder sind, wie man das in letzter Zeit genannt hat, episodische Erzählung. Als weiteres verbindendes Merkmal kann das Fehlen (fast) jeden literarischen Ehrgeizes genannt werden und das damit zusammenhängende, praktisch völlige Zurücktreten der Verfasser hinter ihrem Stoff. Darauf weisen ja schon die Probleme hin, die man bei der Identifizierung der Autoren der Evangelien hat und die wir noch kennenlernen werden. Angesichts dieser Übereinstimmungen scheint es trotz der nicht zu leugnenden Unterschiede sinnvoll, die Evangelien als zu einer literarischen Gattung zugehörig anzusehen und sie nicht verschiedenen literarischen Gattungen zuzuweisen. Das gilt nach meinem Urteil auch für das Lukasevangelium, das sich zwar nach Ausweis seines Vorwortes als einziges Evangelium wie ein historisches Werk gibt (vgl. nur das sehr ähnliche Vorwort des Josephus in BJ I 1), dessen Autor aber von den gleichen Intentionen getragen ist wie die übrigen Evangelisten (vgl. Lk 1,4) und sich auch gegenüber seinen Quellen trotz dieses Vorwortes nicht anders verhält als die übrigen Evangelisten.
2.2 Die Evangelien und die Gattungen der antiken Literaturgeschichte
Wandel im Verständnis der Evangelien
In der deutschen Literatur vor allem war es lange Zeit üblich, die Evangelien als eine eigene Gattung ohne Parallelen in der Antike zu betrachten, obwohl immer wieder auch auf die Übereinstimmung mit anderen Gattungen hingewiesen wurde. Gerade die heute erneut favorisierte Parallelität zur antiken Biographie wurde seit Herder immer wieder zumindest erwogen, wenn auch in der Regel abgelehnt. Dafür gab es unterschiedliche Gründe: Hingewiesen wurde u. a. auf das Fehlen einer Entwicklung des Charakters der Hauptperson, auf das Fehlen eines schriftstellerischen Individuums und den anonymen Wachstumsprozess der Tradition, aus dem die Evangelien quasi als autorloses Produkt wie von selbst hervorgegangen sein sollten. Dieses Verständnis der Evangelien hat sich aber durch die die Formgeschichte ablösende Redaktionskritik erheblich verändert, und der schriftstellerische Wille des Evangelien-Autors steht der heutigen Forschung nicht nur als Erkenntnisziel lebendig vor Augen. Sie begreift die Evangelisten nicht mehr bloß als Sammler, Redaktoren oder Tradenten, wie dies die frühe Formgeschichte tat. Da sich also das Bild der Evangelisten gewandelt hat, ist auch die Frage nach der Gattung neu zu stellen. Man hat deswegen sowohl aus der griechisch- als auch aus der semitisch-sprachigen Literatur alle möglichen Literaturgattungen als Vorbild für die Evangelien vorgeschlagen: Memoirenliteratur, Biographie, Roman, Tragödie, Tragikomödie, Aretalogie, Biographie eines Gerechten, Propheten-Biographie, ► Midrasch (weitere Ableitungsversuche bei Dormeyer, Evangelium und Vorster, Ort). Auf diese muss hier kurz eingegangen werden.
2.3 Ableitungen der Gattung „Evangelium“ aus alttestamentlich-jüdischer und paganer Literatur
Читать дальше
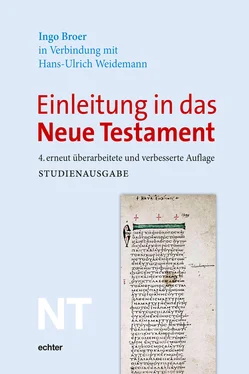
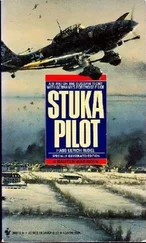


![Felix Sobotta - Das alte Jagdschloss und das neue Haus [Band 1]](/books/493473/felix-sobotta-das-alte-jagdschloss-und-das-neue-ha-thumb.webp)