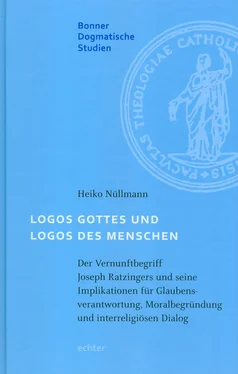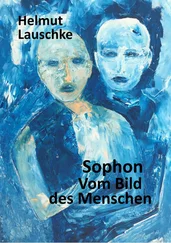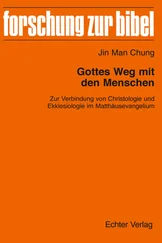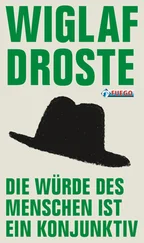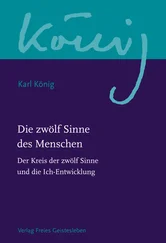Die Naturwissenschaft stößt nach Ansicht Ratzingers dementsprechend sowohl in der Betrachtung des ‚Allergrößten‘, der Himmelskörper, als auch in den Betrachtung des ‚Allerkleinsten‘, der lebendigen Zellen und ihrer genetischen Struktur, auf eine kosmische Vernunft, welche die Wirklichkeit strukturiert. 65„Durch das Ganze, dessen wir ansichtig werden, ob von dem Allerkleinsten bis zum Allergrößten, sehen wir neu und können in Formeln gleichsam jenem Schöpfergeist nachdenken, dem auch unsere Vernunft sich verdankt.“ 66So führen die Naturwissenschaften nach Ratzingers Überzeugung den Menschen zwangsläufig zu der Einsicht, dass Welt „objektiver Geist“ ist. „[S]ie begegnet uns in einer geistigen Struktur, das heißt, sie bietet sich unserm Geist als nachdenkbar und verstehbar an.“ 67
Welcher Gottesbegriff kann nun nach Ansicht Ratzingers aus dieser naturwissenschaftlichen Einsicht einer das All strukturierenden Vernunft abgeleitet werden? Am Gottesbegriff Galileis erläutert Ratzinger, dass es hier nicht um einen personal gedachten Schöpfergott gehen kann. Die Formulierung ‚Gott treibt Geometrie‘ trifft den Kern dieses Gottesbegriffs: „Gott hat das Buch der Natur mit mathematischen Buchstaben geschrieben; Geometrie treiben, das bedeutet zugleich, die Spuren Gottes berühren. Das heißt aber: Die Erkenntnis Gottes wird in Erkenntnis der mathematischen Strukturen der Natur umgewandelt; der Begriff der Natur im Sinn des Objekts der Naturwissenschaft löst den Schöpfungsbegriff ab“ 68. Gott kann unter diesen Umständen nicht als handelnder, personaler Schöpfergott, sondern nur als erste Ursache der Wirklichkeit gedacht werden. Als solche aber ist er „kein Gott mehr, sondern eine naturwissenschaftliche Grenzhypothese.“ 69
In diesem Sinne kann Ratzinger über die moderne Naturwissenschaft sagen, dass sie in der Struktur des Kosmos den ‚Gott der Philosophen‘ gefunden habe. 70Wenn Naturwissenschaftler wie Albert Einstein allerdings auch angesichts dieser fundamentalen Einsicht einen personalen Gottesbegriff als anthropomorph zurückweisen, so zeigt sich darin für Ratzinger das „ganze Problem des Gottesglaubens …: Einerseits wird die Durchsichtigkeit des Seins, das als Gedachtsein auf ein Denken verweist, gesehen, zugleich aber finden wir die Unmöglichkeit, dieses Denken des Seins mit dem Menschen in Beziehung zu bringen.“ 71
Die Frage lautet also, wie man den ‚Gott der Philosophen‘ und den ‚Gott des Glaubens‘ miteinander identifizieren kann. Es wird sich im Laufe dieser Arbeit herausstellen, dass Ratzinger diese Synthese gerade im Christentum verwirklicht sieht. 72Einstweilen ist festzustellen, dass die Naturwissenschaft nach Ansicht Ratzingers mittels ihrer Methode nicht weiter als bis zum ‚Gott der Philosophen‘ vordringen kann, da sie „die Natur in rein mathematischer Gesinnung befragt und folglich auch nur die mathematische Seite der Natur zu Gesicht bekommen kann.“ 73Sie kann den Logos Gottes in der Wirklichkeit vorfinden und braucht ihn als ‚platonische Voraussetzung‘ ihrer Methode. Dabei muss sie sich aber, wie oben erwähnt, philosophischen Spekulationen über seine Beschaffenheit enthalten, da solche ihren methodischen Rahmen überschreiten würden.
Naturwissenschaftliche Vernunft greift in ihrer Methode also auf die vernünftige Struktur der Wirklichkeit zurück und kann den Primat der Vernunft als wissenschaftliche Grenzhypothese gelten lassen, aber keine weiteren Aussagen über ihn machen, geschweige denn in dieser von ihr vorgefundenen kosmischen Vernunft, dem ‚Gott der Philosophen‘, ein personales Gegenüber begreifen. „Zwar gäbe es kein Messen ohne den geistigen Zusammenhang des Seins, also ohne den geistigen Grund, der den Messenden und das Gemessene verbindet. Aber eben deshalb wird dieser Grund selbst nicht gemessen, sondern geht allem Messen voraus.“ 74Der Gott der Philosophen bleibt für die Naturwissenschaften ein notwendiges Axiom, das nicht mehr selbst von ihnen messend erfasst werden kann, sondern als ihre innere Voraussetzung angenommen werden muss. 75
1.4.3. Von der Vernunft der Schöpfung zur Vernunft des Schöpfers
Trotzdem kann man nach Ratzinger sagen, dass sich in der mathematischen Strukturiertheit, im von der naturwissenschaftlichen Vernunft aufgespürten Primat des Logos, Schöpfungsglaube und naturwissenschaftliche Vernunft des Menschen berühren. Denn Schöpfungsglaube bedeutet für Ratzinger „nichts anderes als die Überzeugung, dass der objektive Geist, den wir in allen Dingen vorfinden, ja, als den wir die Dinge in zunehmendem Maß verstehen lernen, Abdruck und Ausdruck ist von subjektivem Geist und dass die gedankliche Struktur, die das Sein hat und die wir nach denken können, Ausdruck eines schöpferischen Vordenkens ist, durch das sie sind.“ 76Im Schöpfungsglauben wird Ratzinger zufolge also hinter der objektiven gedanklichen Struktur des Seins ein denkendes Subjekt als Schöpfer angenommen. Schöpfungsglaube und naturwissenschaftliche Vernunft treffen sich im gemeinsamen Punkt des Primats des Logos, der göttlichen Vernunft: „Die wissenschaftliche Durchdringung der Welt, die einerseits deren NichtGöttlichkeit, andererseits deren logische, geistig zu erhellende Struktur voraussetzt, entspricht zutiefst jenem Weltverständnis, das die Welt als geschaffen (und so selbst nicht-göttlich) und als herkommend aus dem Logos – Gottes geisterfülltem Wort – versteht, von dem her sie selbst logoshaft, geistig strukturiert ist.“ 77
Ratzinger geht nun noch einen Schritt weiter, wenn er den Schöpfungsglauben als einzig mögliche Erklärung der gedanklichen Strukturiertheit der Wirklichkeit behauptet. Er sieht es als evident an, dass „angesichts alles Wissens um die Mathematik des Weltalls mehr als je zuvor … die geistig geprägte Welt auf den Schöpfer-Geist verweist, ohne den der in ihr objektivierte Geist unerklärbar bleibt.“ 78Der objektive Geist, der sich in der mathematischen Struktur des Kosmos ausdrückt, fordert nach Ansicht Ratzingers also notwendig die Annahme eines diese Struktur begründenden subjektiven Schöpfer-Geistes, die Annahme einer schöpferischen Vernunft. 79
Diesen Überschritt von der objektiven Ordnung zum subjektiven Schöpfer-Geist erläutert Ratzinger an anderer Stelle noch einmal, indem er mit Bezug auf Albert Einstein von dem Phänomen ausgeht, „dass unser Denken, unsere im reinen Bewusstsein ausgedachten mathematischen Welten auf die Wirklichkeit passen, dass unser Bewusstsein so strukturiert ist wie die Wirklichkeit und umgekehrt“ 80, wobei diese Kongruenz von Bewusstsein und Wirklichkeit seiner Ansicht nach Naturwissenschaft erst möglich macht. Daraus zieht Ratzinger den Schluss, dass im subjektiven Bewusstsein des Menschen das gleiche Prinzip hervortritt, welches objektiv die Welt bewegt: „Die Welt hat die Art des Bewusstseins an sich. Das Subjektive ist der objektiven Wirklichkeit nicht etwas Fremdes, sondern sie ist selbst wie ein Subjekt.“ 81
Aus der Deckungsgleichheit der menschlichen Vernunft mit den objektiven Phänomenen der Wirklichkeit wird also auf eine das Objektive durchdringende subjektive Vernunft geschlossen, eine schöpferische Vernunft. So kann Ratzinger sagen, „durch die Vernunft der Schöpfung blicke uns Gott selber an.“ 82Zwar können die Naturwissenschaften aufgrund ihrer begrenzten Methode Gott nicht zum Vorschein bringen, doch Ratzinger ist davon überzeugt, dass gerade „durch die Grenze ihrer Aussagemöglichkeiten, die hervortritt, und durch den inneren Verweis, der in ihnen ist, sie uns in Wirklichkeit, wie mir scheint, einen neuen, unerhörten Schöpfungsbericht geliefert haben, mit großen, neuen Bildern, die uns das Angesicht des Schöpfers, den handelnden Gott erkennen und uns von Neuem wissen lassen: Am Urbeginn und Grund allen Seins steht der Schöpfergeist.“ 83
Читать дальше