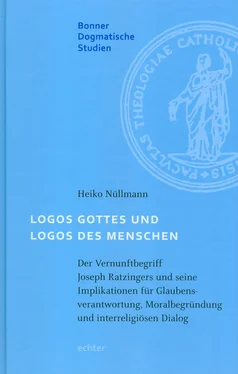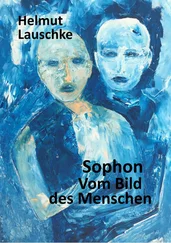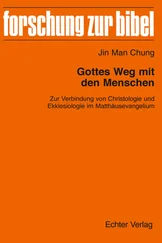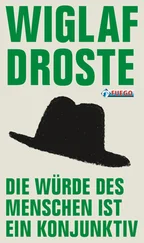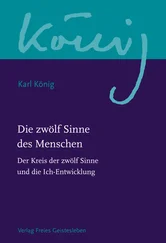1 ...6 7 8 10 11 12 ...26 Daraufhin nennt er neben dem Problem des Sprungs von der Mikro- in die Makroevolution noch drei weitere Lücken in der Evolutionstheorie, die seiner Ansicht nach über die Naturwissenschaft hinaus- und in den Bereich der Philosophie hineinführende Fragen aufwerfen.
Zweitens bezieht er sich dabei auf den großen Zeitraum, von dem in der Evolutionstheorie die Rede ist und der sich seiner Ansicht nach negativ auf ihre Belegbarkeit auswirkt. So seien große Teile der Theorie einfach deshalb nicht nachweisbar, „weil wir 10.000 Generationen nicht ins Labor hereinholen können. Das bedeutet: Es gibt erhebliche Lücken der experimentellen Verifizier- und Falsifizierbarkeit aufgrund des ungeheuren Zeitraumes, auf den sich die Theorie bezieht.“ 105
Drittens betont Benedikt XVI., dass die Wahrscheinlichkeit der Evolutionstheorie nach Aussage von Peter Schuster nicht bei 1 liegt. Das bedeutet für den Papst, dass sie zwar, mit Johannes Paul II . gesprochen, „mehr als eine Hypothese“ darstellt, aber gleichzeitig will er festhalten, „dass die Evolutionstheorie noch keine komplette, wissenschaftlich verifizierte Theorie ist.“ 106
Viertens bezieht der Papst sich erneut auf den Umstand, „dass der Korridor, in dem sich die Entwicklung abspielen konnte, schmal ist.“ 107Die Tatsache, dass dieser Korridor „eröffnet und durchschritten“ 108wurde, kann von der Evolutionstheorie nicht erklärt werden.
So kann Benedikt XVI. zusammenfassend feststellen, dass die Naturwissenschaft und die Evolutionstheorie zwar viele Fragen auf beeindruckende Weise beantworten können, „aber in den vier erwähnten Punkten zeigen sich auch große offene Fragen.“ 109Diese Fragen aber sind seines Erachtens keine Fragen der naturwissenschaftlichen Vernunft mehr. „Dennoch sind es Fragen, die die Vernunft stellen muss und die nicht einfach dem religiösen Gefühl überlassen werden dürfen.“ 110Offensichtlich will Ratzinger darauf hinaus, dass die Evolutionstheorie nur dann wirklich schlüssig ist, wenn man den Gedanken einer ihr vorausgehenden schöpferischen Vernunft philosophisch voraussetzt. Sie muss diesen inneren Verweis auf den Logos des Schöpfers einräumen und darf sich nicht selbst absolut setzen, als könne sie alle Fragen des Menschen beantworten. Dies wäre aufgrund der Bedeutung der betreffenden Fragen für den Menschen folgenschwer. Denn es geht dabei „um die großen Urfragen der Philosophie, die auf neue Weise vor uns stehen: die Frage nach dem Woher und Wohin des Menschen und der Welt.“ 111
Dass Ratzinger die Annahme eines göttlichen Logos als einzige wirklich wissenschaftlich haltbare Hypothese zur Welterklärung versteht und eine sich absolut setzende Evolutionstheorie dagegen als unwissenschaftliches und im Grunde unvernünftiges Weltbild begreift, zeigt sich auch in seinen Auseinandersetzungen mit dem Werk Zufall und Notwendigkeit des französischen Biochemikers und Genforschers Jacques Monod . 112Dabei findet Ratzinger in der Theorie Monods zunächst einige Anknüpfungspunkte für den Schöpfungsglauben, z.B. in Monods Aussage, dass die Wirklichkeit nicht nur von Notwendigkeit bestimmt ist. So gibt es nach Ratzinger für Monod „keine Weltformel, aus der alles zwingend folgen würde, sondern in der Welt gibt es Notwendigkeit und Zufall.“ 113Für Ratzinger liegt dabei im Begriff des Zufalls gerade die Möglichkeit, schöpferische Freiheit zu denken: „Es ist das Nichtnotwendige, das sein konnte bei der Zusammensetzung der Materie, aber nicht sein musste.“ 114
Einen zweiten Anknüpfungspunkt an Monods Denken sieht Ratzinger in dessen Einsichten über den biologischen Organismus, der raffinierter ist als die ausgeklügeltsten Maschinen, sich selbst betreibt und sogar in der Lage ist, sich selbst zu reproduzieren. 115In diesem Reproduktionsvorgang stößt Ratzinger auf die „platonische Seite der Welt“ 116nach Monod. Diese besteht in der Beobachtung, dass jeder Organismus bemüht ist, sich selbst möglichst genau so wieder zu reproduzieren, wie er ist. Evolution ist keine Eigenschaft eines einzelnen Wesens, sondern ein Prozess, der viele Generationen umfasst. Das einzelne Wesen ist dagegen unveränderbar und gibt seine Eigenschaften möglichst genau an die nachfolgende Generation weiter. 117Für Ratzinger bedeutet das: „Es gibt nicht bloß das Werden, in dem sich alles ständig verändert, sondern es gibt das Beständige, die immerwährenden Projekte, die immerwährenden Ideen, die die Wirklichkeit durchleuchten und ihre ständigen Leitprinzipien sind.“ 118Im Begriff des ‚Projekts‘ findet Ratzinger dabei offensichtlich den bleibenden Willen einer schöpferischen Vernunft ausgedrückt, wenn er sagt: „Nur der Schöpfergeist war stark genug und groß und kühn genug, dieses Projekt zu ersinnen.“ 119
Nun stellt sich natürlich die Frage, wie trotz der beschriebenen Konservativität der Natur überhaupt Entwicklung stattfinden kann. Monod antwortet darauf mit dem Verweis auf Übertragungsfehler des Erbgutes bei der Fortpflanzung der Organismen. „Solche Fehler können sich summieren, und aus der Summierung von Fehlern kann Neues entstehen“ 120: „Ist der Einzelne und als solcher wesentlich unvorhersehbare Vorfall aber einmal in die DNS-Struktur eingetragen, dann wird er mechanisch getreu verdoppelt und übersetzt; er wird zugleich vervielfältigt und auf Millionen oder Milliarden Exemplare übertragen. Der Herrschaft des bloßen Zufalls entzogen, tritt er unter die Herrschaft der Notwendigkeit, der unerschütterlichen Gewissheit.“ 121
Bis zu diesem Punkt bezeichnet Ratzinger die Beobachtungen Monods als rein empirisch und geht sie mit. Doch nun folgt ein für ihn „verblüffender Schluss: Auf diese Weise, durch die Summierung von Übertragungsfehlern, ist die ganze Welt des Lebendigen, so ist der Mensch entstanden. Wir sind ein Produkt zufällig sich häufender Fehler.“ 122Diesen Schritt, der den Menschen auf ein bloßes Zufallsprodukt reduziert, kann Ratzinger nicht mitgehen. Die lebendigen Geschöpfe sind für ihn nicht „Produkt von äußeren Zufällen, was immer ihre Faktoren sind.“ 123Denn Monod in diesem Punkt zu folgen, hieße, anzunehmen, „das ganze Konzert der Natur … steige aus Irrtümern und Misstönen auf, lauter Misstöne, die sich wunderlicherweise zu einem Konzert dann zusammenfügen.“ 124Laut Ratzinger hat Monod damit selbst die Absurdität seiner Aussagen eingeräumt. Denn wie kann aus lauter Misstönen ein Konzert entstehen?
Monods Fehler liegt für Ratzinger darin, dass er den Gedanken einer schöpferischen Vernunft von vornherein als unwissenschaftlich ausklammert und deshalb zu einer widersprüchlichen Aussage gelangt: „Ich denke, hier erweist sich dann doch eine bestimmte Definition von wissenschaftlicher Methode als unvernünftig und damit auch unwissenschaftlich, denn Wissenschaft hat wohl mit Vernunft zu tun.“ 125Monods Theorie kann also nach Meinung Ratzingers aufgrund fehlender innerer Logik nicht vor der menschlichen Vernunft standhalten, da sie nur die naturwissenschaftliche Vernunft zu Wort kommen und darüber hinaus keine andere Form der Vernunft gelten lässt.
Aufgrund dieser Engführung des Vernunftbegriffs ist Monod wie andere Evolutionstheoretiker Ratzinger zufolge gezwungen, Wissenslücken in der Theorie durch „mythologische Versatzstücke“ 126zu überbrücken, „deren Scheinrationalität niemanden im Ernst beeindrucken kann“ 127. Ratzinger verweist an dieser Stelle auf Formulierungen in Monods Zufall und Notwendigkeit , bei deren Lektüre es seines Erachtens schwerfällt, „etwas anders als Selbstironie des Forschers zu sehen, der von der Absurdität seiner Konstruktion überzeugt ist, sie aber aufgrund seines methodischen Entscheids … aufrechterhalten muss.“ 128
Eine sich absolut setzende Evolutionstheorie ist für Ratzinger also höchst unvernünftig, weil sie von der für sie notwendigen Annahme der schöpferischen Vernunft abstrahiert, deren Ergänzung sie seiner Ansicht nach bedarf, um die Entstehung der Arten in wirklich umfassender Weise zu erklären. Denn die „großen Projekte des Lebendigen“ sind für ihn eben nicht „Produkte einer Selektion, der man Gottesprädikate beilegt, die, an dieser Stelle unlogisch und unwissenschaftlich, ein moderner Mythos sind.“ 129Sie verweisen vielmehr „auf einen, der Projekte hat, verweisen auf schöpferische Vernunft.“ 130
Читать дальше