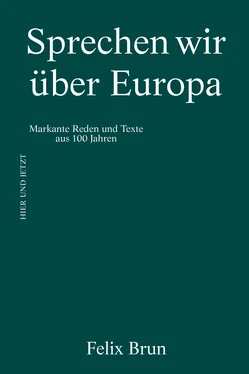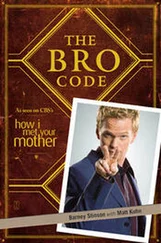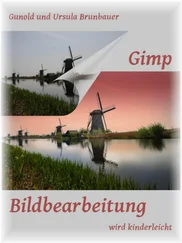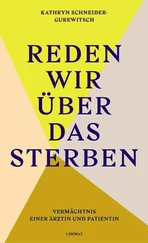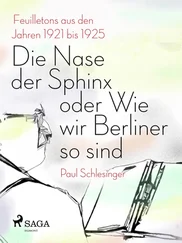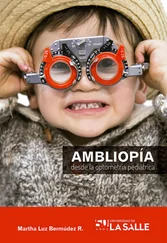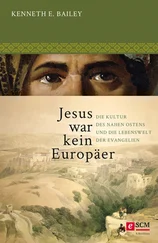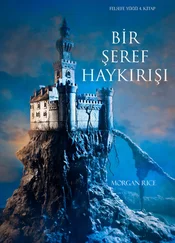Die Vernunft, auch die Demokratie, «das ist glanzlos», 125sagt Peter von Matt jetzt. Eine komplexe Sprache, viele mögliche Wahrheiten, Dialog und Kompromiss, wahrlich, diese Begriffe leuchten nicht sehr hell. «Die Demokratie hat im Arsenal der grossen Träume keinen Platz. Ihr Wesen ist der Kompromiss, das Beigeben, sind immer nur die halben Siege als immer auch halbe Schlappen.» 126«Unansehnlich von Natur aus» 127ist die Demokratie in den Augen Peter von Matts, sie ist «umständlich» und «schildkrötenhaft langsam». 128Die Demokratie hat also ihre Schwächen, sie ist vielleicht zu träge in der sich hektisch bewegenden Welt, doch für den Germanisten gehört der «demokratische Staat […] zu den höchsten Errungenschaften, die es auf unserem gequälten Planeten gibt». 129Aber: Demokratie ist schwierig. 130Demokratie gibt zu tun, «auch die Schweiz hat zu tun gegeben». 131Wer den Blick öffnet, von der Schweiz auf Europa hin, der findet hier einen Anknüpfungspunkt. Die Schweiz hat in Sachen Demokratisierung bereits einen langen Weg beschritten und verschiedene Krisen erfolgreich überwunden. Sie ist hier weiter als Europa, das sich in der bildhaften Beschreibung Peter von Matts «etwa im Zustand eines Pubertierenden» befindet, «der seinen Eltern schlaflose Nächte macht». 132Demokratie braucht Geduld, doch was aus der Demokratie entsteht, ist kristallklar, hat Wert, hat Substanz. «Die wirklichen Abläufe geschehen gletscherhaft langsam in der Tiefe», 133sagt Peter von Matt und rückt damit die alpine Schweiz in das Zentrum Europas. Föderalismus und direkte Demokratie, das sind die nächsten Etappen der «langen Reise», die das pubertäre Europa noch zu gehen habe, und die Schweiz könne hier ein «Wegweiser» 134sein.
Man kann also argumentieren, dass Demokratie und Aufklärung an ihrer Langsamkeit, an ihrer Langweiligkeit kranken. Das scheint auch Friedrich Schiller erkannt zu haben, und so hat er seinen Wilhelm Tell als ein gewalttätiges Gegenstück zum friedlichen, pathetisch aufgeladenen Rütlischwur in Szene gesetzt, ihm sozusagen ein bisschen Würze verliehen. Tell ist, um hier weiterhin am Gegensatz von Gewalt und Liebe festzuhalten, der Intrigant, wie ihn Peter von Matt beschreibt: «Der Intrigant […] sagt: Ich mache es selbst. […] Mein Schicksal bin ich selbst, und so handle ich auch.» 135Wilhelm Tell als Intrigant? Das grenzt schon beinahe an Gotteslästerung. Doch Peter von Matt kann sich erklären: Schlüssig argumentiert er, dass Tell ein Wilder sei, ein «Waldmensch, der keinen braucht, der sich selbst genug ist, der alles kann», ein «Einzelgänger, mehr noch: Er ist ein vorpolitischer Mensch», ein «Nichtrepublikaner». 136Peter von Matt findet in einer der wichtigsten literarischen Figuren der Schweiz mehr als viele andere vor ihm. Nicht die Gewalt, nicht der Tyrannenmord sind die zentralen Motive, sondern Tells Eigenbrötlerei. Doch in seiner Einsamkeit gehört Tell für ihn nicht zu den «tatsächlichen politischen Leistungen der Schweiz». Die wahren Leistungen, «das sind: die Kunst des politischen Kompromisses, die verhinderte Machtballung bei Einzelpolitikern und die überproportionale Förderung der Minderheiten». 137Nicht der gewalttätige und einsame Wilhelm Tell ist demnach für von Matt die grosse Leistung Schillers, sondern der Schwur auf dem Rütli: «Mich persönlich interessiert die Inszenierung der Menschenrechte am meisten. Das war das Gebot der Stunde. In der Rütliszene der Gestus: Wir holen die ewigen Gesetze vom Himmel herunter, im Sinne einer Berufung auf das Naturrecht.» 138Das ist grossartig. Den Wilhelm Tell – er stammt übrigens aus Dänemark, auch das verrät uns von Matt einmal – des deutschen Autors Schiller als ein Produkt der Französischen Revolution, des europäischen Humanismus verstehen zu können, das kann nur dem «Europäer» 139Peter von Matt gelingen. Damit ist Schillers Wilhelm Tell mehr als ein Stück über die «symbolische Gewalt der Berge», 140es ist ein Stück über das «politische Know-how der Schweiz», über «ihre in Jahrhunderten entwickelte Versöhnungskultur». 141
Europäer ist der Schweizer Peter von Matt durch die Literatur geworden. Die Schweizer Literatur ist seit ewig mit Europa verbunden, ist von Matt überzeugt, sie besitzt eine «doppelte Staatsbürgerschaft», 142sie ist immer einerseits schweizerisch, andererseits aber auch europäisch, da sie sich an den grossen Sprachräumen des Deutschen, des Französischen und des Italienischen orientiert. Weiter weist von Matt darauf hin, dass die Schweiz für Napoleon «offensichtlich eine europäische Angelegenheit» 143war. Für Peter von Matt gibt es daher immer eine enge Verflechtung der Schweiz mit Europa, deren Beziehung reziprok ist: Die Schweiz kann Europa ein Wegweiser zu mehr Demokratie und Föderalismus sein, Europa wiederum hilft mit, die Schweiz als kleinen Staat zu beschützen und ihr ihre Neutralität zu lassen.
Auch wenn Tell beim Rütlischwur durch seine Abwesenheit glänzt, so ist das Stück von Friedrich Schiller doch Teil des europäischen «Raums der Inspiration». 144Wo die Politik versucht, Wilhelm Tell zum Eidgenossen zu machen, da macht ihn die Literatur zum Europäer. Die Literaten Europas, «die schaffenden Geister», 145kommunizieren miteinander, sie überschreiten Grenzen und lassen ihre Helden dieselben Grenzen überschreiten. «Don Quijote reitet über alle Grenzen» heisst das dann bei Peter von Matt. Es gibt offensichtlich keine Nationalliteratur; alle Literatur ist für ihn grenzüberschreitend. Alles Nationalisierende ist zu verwerfen, alle Versuche, ein Volk als etwas Homogenes darzustellen, verlieren ihre Gültigkeit, der «Stacheldraht an den Grenzen der Staaten» 146wird belanglos, die Gewalt muss verworfen werfen und mit ihr die Vereinfachung. Was zählt, ist die Liebe, ist die Verbindung, ist die Diskussion, und «wenn es eine europäische Identität gibt, dann wurzelt sie hier, im gemeinsamen Raum der Inspiration». 147
In der Literatur findet der Germanist Peter von Matt zu den Menschen. Sie leben in Räumen, nicht in Nationalstaaten. Sie wurzeln in der Vergangenheit, prägen einander und sind durch andere Menschen diejenigen geworden, die sie heute sind. 2007, zwei Jahre vor der Rede Peter von Matts auf der Rütliwiese, konnte die Schweizerische Volkspartei (SVP) unter Christoph Blocher bei den Parlamentswahlen grosse Erfolge verbuchen. Im Dezember dann folgte ein schwerer Rückschlag: Christoph Blocher wurde als Bundesrat abgewählt. Er eckte offenbar zu sehr an, mit seiner kompromisslosen Art zu politisieren. Wer «sich zum Häuptling aufwerfen will», sagt Peter von Matt zwei Jahre später in seiner 1.-August-Rede auf dem Rütli, der werde «eines Tages auf dem dafür vorgesehenen Körperteil» landen. Doch Blocher bleibt im Hintergrund weiterhin wichtig.
Der 1. August 2009 ist ein strahlend schöner Tag. Die Menschen strömen auf die mythisch aufgeladene Rütliwiese. Nicht weit von der schweizerischsten aller Wiesen brettert halb Europa durch den Seelisbergtunnel. Peter von Matt blickt in seinem Referat zum Schweizer Nationalfeiertag – wie es seiner Art zu denken und zu sprechen entspricht – hinter die Kulissen und entdeckt Neues. «Es ist schön hier», mit diesen Worten begrüsst der Redner die versammelte Festgemeinde. Das Rütli aber verweise nicht nur auf Wilhelm Tell und den Tyrannenmord, sondern auch auf das Stanser Verkommnis – das Übereinkommen der Acht Orte, mit dem der Konflikt beigelegt wurde – und damit auf den Kompromiss. Der Rütlischwur sei nicht nur eine Geschichte des nationalen Zusammenhalts, sondern auch der Verbundenheit der Schweiz mit Europa. «Die Schweiz ist unsere Heimat, aber die Heimat der Schweiz ist Europa», sagt Peter von Matt in einem mittlerweile berühmt gewordenen Satz auf dem Rütli. Die Neue Zürcher Zeitung macht ihn denn in ihrem Kommentar zur «würdigen und gehaltvollen Feier» auf dem Rütli auch zum Titel des gesamten Textes und weist darauf hin, dass von Matt auf dem Rütli vom Frieden gesprochen habe, davon, dass wir «als erste Menschen» erleben könnten, dass «die europäischen Grossmächte seit einem halben Jahrhundert keinen Krieg mehr gegeneinander führten». 148
Читать дальше