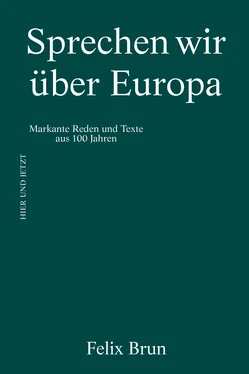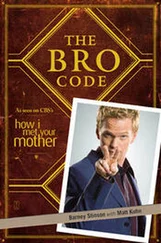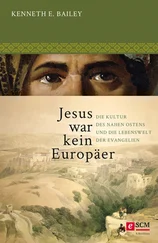Ganz zu schweigen vom Geld, das der öffentlichen Hand durch die Schlaumerei entzogen wird. Die demographische Entwicklung wird die Altersvorsorge zusätzlich demontieren, aber darüber hört der Schweizer selten Verlässliches. Sicher ist nur: Die Kantone stöhnen unisono unter Haushaltsdefiziten. Und auch diese Jeremiaden werden so wenig Anlass zum Handeln wie der von der Regierung längst versprochene Energiewandel. Der älteste Atommeiler der Welt steht bekanntlich auf schweizerischem Boden. Das Kernkraftwerk Beznau produziert ebenso zuverlässig Strom wie Störfälle. Internationale Experten schütteln über die Fahrlässigkeit den Kopf. Die Aktien der Trägergesellschaft liegen vollständig in den Händen der Kantone, und die verspüren wenig Lust, für sicheren Strom mehr Geld zu bezahlen. Und so lässt man den Lotter-Reaktor weiter brennen. Und hofft, der Herrgott im Himmel möge der Eidgenossenschaft weiter so gnädig sein wie bisher und das Schlimmste verhindern.
Niemand sollte glauben, dass sich das Land nicht verändert. Im Gegenteil. Es transformiert sich so schnell wie Ektoplasma aus Hollywood. Die Form, die es sich anzunehmen schickt, ist nicht dem himmlischen Schicksal überantwortet, sondern reagiert, wie jedes Plasma, auf Druck. Und Druck ist reichlich da. Dass sich die Schweiz seit zwanzig Jahren in einem Kulturkampf befindet, bezweifelt niemand mehr. Obwohl es einige Pessimisten gibt, die behaupten, dieser Kampf sei bereits entschieden und seit kurzem vorbei.
Die nationale Rechte lässt die Bären tanzen, wo und wann sie will. Was die Schweiz von Ländern wie Frankreich und Österreich unterscheidet, sind die 3,6 Milliarden Privatvermögen, über die der Extremismus hierzulande verfügt. Geld in den Händen eines chemischen Industriellen, Christoph Blocher, der seit Jahr und Tag das Land mit seinen obskuren Ideen inspiriert. Kunstsinnig wie immer, ist er auf seine alten Tage zudem grosszügig geworden. Der Mann besitzt nicht nur Milliarden, er scheint mehr und mehr gewillt, sie auch auszugeben.
Zum Frühstück spendiert er sich die erste öffentliche Ausstellung seiner privaten Gemäldegalerie in einem respektablen Kunstmuseum, dem Oskar Reinhart Museum in Winterthur, das des Industriellen Sammlung hiesiger Genremaler ausstellen darf und ihn dafür mit dem Glanz des Gönners salbt. Und weil ein rechtsnationaler Sammler mit Sendungsbewusstsein ein paar Selbstporträts veröffentlicht sehen will, kauft sich der Mäzen gleich die passende Publikation dazu. Das Du-Magazin, über Jahrzehnte das Zentralorgan des honorablen, kunstbeflissenen Bürgertums, hat praktischerweise sein Konzept gewechselt. Nun kann jeder, der sechzigtausend Schweizer Franken zu zahlen bereit ist, das Blatt komplett buchen, und niemand stört sich daran, dass eine Zeitung, die einmal bekannt war für die Arbeiten von Werner Bischoff und Hugo Lötscher, eine Woche vor den nationalen Wahlen den politischen Extremismus mit den Weihen der Kunst bemäntelt und rechtfertigt.
Das bunte Blatt im Hochformat reiht sich damit ein in die neue mediale Front, die von der Zürcher Weltwoche über die Basler Zeitung alle jene verbindet, die bereit sind, ihre journalistischen Standesregeln zu verhökern. Das Geschäftsmodell dieser Parteiorgane sorgt sich längst nicht mehr um Inserate, Abonnenten oder gar Leser. Wie die Defizite gedeckt werden, hat selten jemand gefragt, nie jemand recherchiert. Einer solchen Aufgabe scheinen die schweizerischen Medienhäuser zurzeit nicht gewachsen zu sein. Man begnügt sich mit den notorischen Lügen der Beteiligten.
Gezählt wird nur noch mit neun Nullen
Schweizerische Medien? Muss man sich um sie Sorgen machen? Man muss nicht, aber man sollte vielleicht. Der Durchmarsch der Rechten hat gerade erst begonnen. Den Sturm auf die Chefredaktion der Neuen Zürcher Zeitung konnte eine mutige Redaktion gerade noch verhindern. Bei der Neubesetzung der Feuilletonleitung ist ihr das leider nicht mehr gelungen. Der rechte Verwaltungsrat hat aus der vorigen Niederlage gelernt und im letzteren Fall den Arbeitsvertrag wohl zuerst unterschrieben – und dann erst über die Personalie informiert. Was vom neuen Kulturchef zu erwarten ist, bleibt abzuwarten. Ein Schuft, der an seiner Haltung zweifelt, nur weil sein letzter Arbeitsort eine Publikation mit einschlägig faschistischer Vergangenheit ist. In diesem Familienstück der Reaktionäre hiess der Chefredakteur früher ‹Hauptschriftleiter›, die Financiers hofierten Hitler und versorgten den Faschismus mit Barschaft. Heutzutage kommt das Geld von einem Privatbankier, der sein Institut unter dem Druck der amerikanischen Steuerbehörden verscherbeln musste. Aber auch danach blieb offensichtlich genug Geld und Einfluss übrig, um seinen journalistischen Zögling in eine der einflussreichsten Positionen der deutschsprachigen Publizistik zu hieven. Qualifikationen? Unnötig. Internationale Erfahrung? Das wäre in diesen Tagen geradezu unerwünscht.
Aber es gibt ja noch die Konkurrenz auf der anderen Seite der Sihl. Leider scheint auch mancher Redaktor des Tages-Anzeiger mittlerweile von den ewigen Budgetkürzungen zermürbt. Anders kann man es sich nicht erklären, dass der dortige Kulturchef in dasselbe Horn wie jener Schriftsteller bläst, der neulich in der NZZ zur Schliessung von Theatern aufgerufen hat und obendrein die nicht ganz von der Hand zu weisende Behauptung aufstellte, Dichter von seiner Sorte gebe es zu viele – ein Mann, der am Schweizerischen Literaturinstitut den Nachwuchs ausbildet. Solche spektakulären Pointen kann man bei der NZZ noch verlässlich dem neoliberalen Schema und ihrem Duktus zuordnen.
Beim Tages-Anzeiger scheinen sie bisweilen nur noch verwirrt zu sein. Das ist allerdings kein Wunder in einem Haus, das fünfzig Prozent des Geschäfts nicht mehr mit Journalismus, sondern mit Adresshandel und einem Internetauktionshaus verdient. Noch weniger erstaunlich ist es, wenn man weiss, dass in diesem Mischkonzern in den letzten Jahren eine gute Milliarde von den Redaktionen zu den Aktionären verschoben wurde. Hierzulande zählt man nur noch mit neun Nullen. Für manches Rückgrat in den Redaktionsstuben ist das nicht ohne Folgen geblieben.
Hoffnung brächte eigentlich das gebührenfinanzierte Staatsfernsehen. Doch was man dort von Kritik hält, zeigt sich in der Art und Weise, wie man mit Intellektuellen umspringt. Ein kritischer Film über die Schweiz, verantwortet vom Schriftsteller Robert Menasse und dem Übersetzer Stefan Zweifel, wurde kurzerhand aus dem Programm gekippt. Und auch hier fanden die Verantwortlichen, als sie sich nach Tagen zum ersten Mal vernehmen liessen, nur die Fadenscheinigkeit der mangelnden Qualität und also die bekannte Rückzugsposition aller Feiglinge als Rechtfertigung für die Zensur. Vertrauen kann ein Schweizer Bürger heute eigentlich nur noch auf die Justiz. Allerdings nicht auf die schweizerische, sondern auf die amerikanische. Sie sorgt regelmässig dafür, dass die Eidgenossenschaft den Kontakt zu den zivilisatorischen Nationen nicht ganz verliert. Ohne die Staatsanwälte aus Übersee hätten die Banken das Gold der ermordeten Juden bis heute nicht zurückbezahlt. Die internationalen Steuerhinterzieher würden sich immer noch auf das Bankgeheimnis verlassen können. Und korrupte Sportfunktionäre könnten weiterhin unbehelligt von Zürich aus die Jugend der Welt an den Mammon verkaufen. Da nimmt man als Bürger die peinlichen Wildwest-Szenen aus den Strassen Zürichs, die im Sommer um die Welt gingen, gerne in Kauf. Ein Volk von Zwergen will man hierzulande sein und bleiben. Darauf besteht man durch alle sieben Böden und bis ins hinterste Tal. Und man zeigt sich jetzt immer erstaunter, dass man vom Ausland plötzlich auch als Zwerg behandelt wird. Die Schweiz hat immer weniger zu sagen. Die Verhandlungen über das europäisch-amerikanische Freihandelsabkommen finden selbstverständlich ohne die Schweiz statt. Die neuen Bestimmungen in allen wirtschaftlichen Bereichen werden die Schweiz in einer Weise verändern, die die Torturen der letzten Jahre als lockere Dehnungsübungen aussehen lassen werden. Als Schweizer hat man dazu kein Wort zu sagen, aber wir werden natürlich nachvollziehen müssen. Der einzige Trost liegt im Umstand, dass man sich auch daran mittlerweile gewöhnt hat. Ein guter Teil der eidgenössischen Verwaltung ist damit beschäftigt, Gesetze nachzuvollziehen, die nicht in Bern, sondern in Brüssel oder New York erlassen wurden.
Читать дальше