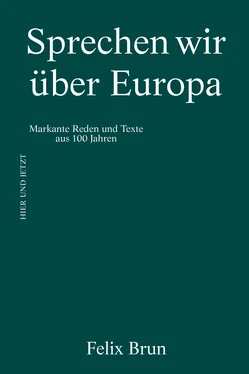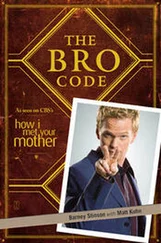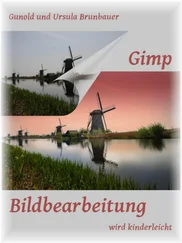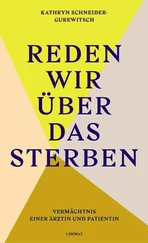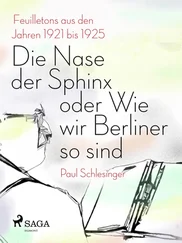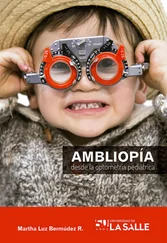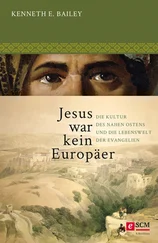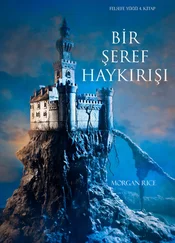Ein Denkfehler. Nicht die Einzigartigkeit der Menschen macht sie einsam, sondern ihr Unvermögen, ihr Unwissen darüber, wie mit dieser Einzigartigkeit umzugehen ist, inwiefern sie für sie ein Gewinn sein kann. «Der Zeitgenosse», so Bärfuss kritisch, «hat gelernt, seinen Alltag pragmatisch anzugehen. Das heisst in seinem Fall: darauf zu achten, als wirtschaftliches Subjekt zu bestehen.» 50Die Anpassung, die Leere, das Lauwarme, die Gemütlichkeit: Immer wieder streben die Figuren in Bärfuss’ Texten danach. Dem widerspenstigen Tony werden mittels eines chirurgischen Eingriffs des Autors im Stück Zwanzigtausend Seiten kurzerhand alle schlechten Seiten wegoperiert. «Wir konnten die Seiten, die Tony belastet haben, entfernen und durch solche ersetzen, mit denen er sein Leben erfolgreich gestalten kann», 51erklärt die Therapeutin der Leserin, dem Leser jetzt nüchtern. Der Makel gilt nicht mehr als Spezialität, sondern als störendes Geschwür. Der Rückzug in sich selbst wird bei Bärfuss zu einem Credo, niemand möchte mehr anecken, niemand dem anderen zur Last fallen. Die Jugend und mit ihr das Aufbegehren, das Rebellieren wird zu einer «Provokation». 52Kritische Stimmen werden rar, sie werden zu Ikonen, wie der Journalist Niklaus Meienberg, der im Stück Meienbergs Tod als Einziger noch «Lust verspürt, diese Körper zu öffnen, um zu sehen, ob etwas lebt unter diesen Haarschnitten». 53Ordnung muss herrschen in der heutigen Welt, alles hat seinen Platz und sollte auch dort bleiben. «Die unwillkürlichen Bewegungen: unsere Gesellschaft hasst sie, sie hasst den Kontrollverlust», 54so Bärfuss.
Nirgends lässt sich dieser Rückzug in die Unbewegtheit schöner beobachten als in der Schweiz. Bärfuss’ Literatur handelt von und in der Schweiz. Hundert Tage, sein wohl bekanntester Roman, ist der Bericht eines Schweizer Entwicklungshelfers in Ruanda. Was sich für den Entwicklungshelfer David Hohl in angenehmer Vertrautheit zunächst wie eine Ferienreise in ein «kleines, bergiges» und von «schweigsamen, misstrauischen und fleissigen Bauern» 55bewohntes Land ausnimmt, entwickelt sich zu einem Horrortrip inklusive unbewusster Mittäterschaft am Völkermord in Ruanda. Da wird der Name David Hohl natürlich zum Programm. David, der Retter, bleibt inwendig erstaunlich pragmatisch und leer. Hohl sucht das Abenteuer im dunklen Afrika, weil der Friede in der Schweiz «sich durch Langeweile» 56auszeichnet. Als die Gewalt ausbricht, verfliegt damit für Hohl auch die Langeweile, und er hätte «etwas darum gegeben, wenn in meinem Land so viel in Bewegung gekommen wäre wie hier». 57
Die perfekte Ordnung, die grösstmögliche Sauberkeit: «So ein schönes Land. Die Schweiz. Bei uns sind die Bahnhöfe ja Löcher. Aber hier. So menschenfreundlich», 58sagt Alice, die sterbewillige Deutsche, einmal in Alices Reise in die Schweiz. Wer das anders sieht, der kommt in den Geschichten von Lukas Bärfuss schnell unter die Räder, der führt ein schwieriges, ein prekäres, ja ein gefährliches Leben. Da «hierzulande alles, was exzellent sei, gleichzeitig eine Gefahr darstelle», müsse man sich in das Ordinäre, ins Gewöhnliche flüchten, «da jeder stinke, müssen alle stinken, da dieses Land eine Latrine sei», 59erklärt ein aufgebrachter Professor einmal unter der Feder von Bärfuss. Ab und an beklagen sich die Figuren zwar darüber, dass es in der Schweiz «kaum mehr Menschen» gebe, «die ausbrechen wollen», 60doch es sind einzelne Ausrufe, das traute Heim, die Wohlbehaglichkeit, die Sicherheit ist dann doch wichtiger, «Sicherheit ist alles», 61so der Autor an anderer Stelle.
Was die Figuren von Bärfuss nicht oder erst viel zu spät merken, ist, dass auch in der Ordnung und in der Sicherheit eine Gefahr liegt, gar eine lebensbedrohliche. Erst im Nachhinein, im sicheren Zuhause in der Schweiz, geht dem Entwicklungshelfer David Hohl auf, dass es vielleicht «eine Symbiose gab zwischen unserer Tugend und ihrem Verbrechen», eine Symbiose also zwischen einerseits unseren Schweizer Tugenden wie «Ordentlichkeit, Sauberkeit, Ehrlichkeit, […] Fleiss» 62und andererseits dem 100 000-fachen Abschlachten der Menschen in Ruanda. Erst hier in der Schweiz beginnt David Hohl zu ahnen, «dass in der perfekten Hölle die perfekte Ordnung herrscht». 63Die Sicherheit ist angenehm, klar, aber sie führt auch «zu Erstickungsanfällen. Die Menschen leben nicht, sie tun nur so». 64Nicht zu retten sind die Menschen, wenn sie nur noch nach Sicherheit streben. «Rette uns», fleht «die Dicke» ihre Kontrahentin Erika einmal an, doch diese will nicht: «Ihr seid nicht zu retten.» Da erkennt die Dicke plötzlich, wie es um sie und die Menschen, die sie umgeben, steht: «Wir sind leer», antwortet sie, «fülle uns mit deinem Glauben.» 65
Ein möglicher Ausweg aus dem lähmenden Stillstand ist die Bewegung, die Auseinandersetzung, das Verlassen von Sicherheiten, die Provokation, die Rebellion. Für den Entwicklungshelfer David Hohl waren die 100 Tage in Ruanda auch ein Abenteuer. Endlich ging etwas. Die Lust am Krieg, auch am Tod, sie hilft den Figuren in den Stücken von Lukas Bärfuss immer dann, wenn die Leere unerträglich wird. «Heil dir, Gegenwart, dass du uns wieder Kriege führen lässt», sagt Hans zu Niklaus Meienberg, dem Rebellen, «unsere Worte haben wieder die grösste und erhabenste aller Entsprechungen in der Wirklichkeit: den Krieg.» 66Hans freut sich auf das Gemetzel, darauf, dass «wir uns endlich wieder im Krepieren [werden] üben» 67können. Das Ausbrechen aus der Langeweile kann aber auch, wie von Bärfuss in seinem Roman Koala beklemmend aufgezeigt, der Weg in den Freitod sein. Es ist die Geschichte über den Selbstmord des Bruders, welcher mit der Entscheidung, sich das Leben zu nehmen, «endgültig und ohne Widerruf die Arbeit verweigert». 68Die heutige Gesellschaft überdeckt den Stillstand mit Arbeit, mit Fleiss. «Die Medizin gegen die Angst», die Angst vor dem Stillstand, ist «der Fleiss». 69Man arbeitet sich die Angst vor der Auseinandersetzung mit dem Stillstand weg und merkt nicht, wie man ein wirtschaftliches Subjekt im weltumspannenden System des Kapitalismus ist, gesichtslos und ohne Spezialität, ein «Zahnrädchen» im «Räderwerk dieser Gesellschaft», das so «reibungslos ineinandergreift» ohne Knirschen und Knacken. 70«Der Mensch ist gefangen in Kreisläufen.» 71Eine nicht gerade optimistische Betrachtung der menschlichen Existenz.
Doch ausweglos ist die Situation nicht. Ganz am Anfang der menschlichen Existenz steht die Erkenntnis, die Eva – ihr Name ist kein Zufall – im Stück über Meienberg hat: «Kein Mensch ist eine Insel.» 72Alleine kann der Mensch nicht leben. Er braucht ihn umgebende Menschen, die mit ihm in Dialog stehen. Gegen den Stillstand, gegen die Einsamkeit hilft die Konfrontation. Wer leben will, muss sprechen. «Es gibt etwas, das man nicht zerstören kann, solange es Menschen gibt», sagt John, der Literaturagent, zum widerspenstigen Tony. «Etwas, das weiterlebt, lebendig bleibt. Was wissen wir von den Römern, von den Rittern und den Seefahrern. Nichts als ihre Geschichten. Es gibt nichts Stärkeres als eine Geschichte.» 73Der genuine Ort, an dem die menschlichen Geschichten erzählt werden, ist das Theater. Das Theater ist Bärfuss’ grosse Leidenschaft. Dass Geschichten gefährlich sein können wie der Krieg, aufregend wie ein Abenteuer im dunklen Afrika, das ist bei Bärfuss offensichtlich. «Es ist gefährlich, ins Theater zu gehen. Ein Theater ist ein Irrenhaus», 74sagt die Figur Niklaus Meienberg einmal. Im Theater wird der Mensch zerlegt. Seine Widersprüche, seine Konflikte, seine Ängste werden plötzlich sichtbar. Man könnte zwar meinen, alles sei nichts als Spiel, doch die Erkenntnis, die aus diesem Spiel gewonnen wird, ist real, sie ist lebensecht. Das berühmte Spiel Hamlets vor seinem Stiefvater, dem neuen König, wird zu einer Anklage und gleichzeitig zu einem Prozess. Die unmittelbare Reaktion des Königs auf das Theaterspiel überzeugt Hamlet von dessen Schuld am Mord seines Vaters. Auch Bärfuss’ Stücke, wie er sie simpel nennt, ermöglichen Erkenntnis. Die wohl wichtigste Erkenntnis ist die: Die Menschen sind vielfältig, die Konflikte ohne Zahl und Zeit. Wir erfahren im Theater also Möglichkeiten, wie mit menschlichen Konflikten umzugehen ist, oder, vielleicht ist das sogar noch wichtiger, wir erfahren, wie mit menschlichen Konflikten eben gerade nicht umzugehen ist, will man sich nicht plötzlich tot auf einer Bühne wiederfinden.
Читать дальше