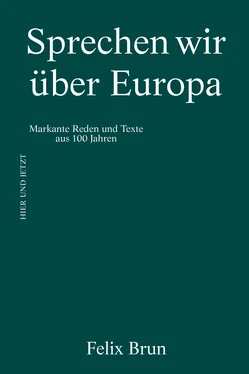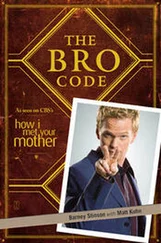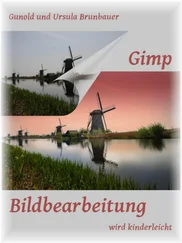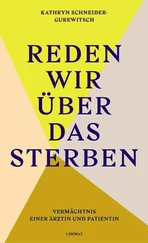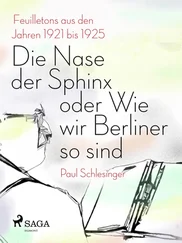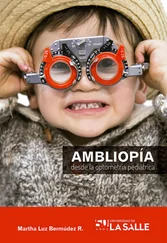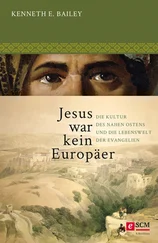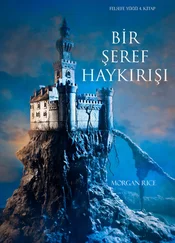Die Polemik in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kommt nicht gut an. Sie wird in den Schweizer Medien verrissen. Im Zürcher Tages-Anzeiger werden die von Bärfuss beschriebenen Zerfallserscheinungen der Schweiz kurzerhand auf seine eigenen «analytischen Fähigkeiten» 98übertragen. Man wirft dem Autor vor, dass er seinen Text nicht gut recherchiert habe, sondern mit «Schaum vor dem Mund» eine «undifferenzierte» Attacke geführt habe. 99Wer «von der Schweiz, diesem ökonomisch und künstlerisch potenten Land, als einem ‹Volk von Zwergen› spricht», so der Ressortleiter Kultur des Tages-Anzeigers, der bleibe «fern der Realität». 100Wehe, wer es wagt, die Schweiz in ihrem Stolz zu verletzen. Der Chefredaktor der Aargauer Zeitung moniert in einem Kommentar, dass Bärfuss in seinem Text «nichts zu sagen» habe, «was man nicht schon anderswo – und dort stringenter formuliert – gelesen hat». 101Auch die Basler Zeitung nennt die literarischen Fähigkeiten von Lukas Bärfuss «limitiert» und den Autor selbst einen «literarischen Grobmotoriker», der sich «in seiner geistigen Provinz» verschanze. 102Lukas Bärfuss hat die Schweizerinnen und Schweizer persönlich angegriffen, jetzt wird zurückgeschossen. Pedro Lenz, Schriftsteller aus Olten, hat das kommen sehen und Lukas Bärfuss in einem offenen Brief gewarnt: «Ich warne dich vor der Rache derer, die du herausforderst. Es gibt nichts gratis bei uns, nicht einmal die Gratispresse ist gratis. Sie werden dich plagen. […] Auf dich als Person werden sie zielen, plump, aber böse […].» 103
Am darauffolgenden Wochenende sorgten die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für einen weiteren Rechtsrutsch im Parlament. Das Verhältnis der Schweiz zur EU ist nach wie vor schwierig. Eine Lösung der zahlreichen Probleme, die anstehen – wie etwa ein Rahmenabkommen –, ist weiterhin nicht in Sicht. Nase zuhalten und abwarten: An dieser helvetischen Devise änderte sich auch nach der Polemik von Lukas Bärfuss nichts.
Die Schweiz ist des Wahnsinns, FAZ 15.10.2015
«Am kommenden Sonntag wählt die Schweiz das neue Parlament. Der dritte Rechtsrutsch in sechzehn Jahren scheint eine ausgemachte Sache zu sein; aber was viele hierzulande in Unruhe versetzt, ist nicht der Wahlsonntag, sondern der ebenfalls nahende 26. Oktober.
An jenem Montag läuft nämlich die Frist aus im Sammelspiel, das Migros, der grösste Einzelhändler der Schweiz, in diesen Tagen veranstaltet. In seinen Filialen gibt es für jeden Einkauf über zehn Franken ein Glücksbeutelchen, darin eine von insgesamt fünfzig nationalen Sehenswürdigkeiten. Mit im Beutelchen ein Sticker, den der Sammler in ein Album kleben darf. Die Gebühr für das Heft wird durch die aufwendige Gestaltung gerechtfertigt. Vierfarbig glänzen da die schönsten Schönheiten des Schweizerlandes. Das Spalentor zu Basel, der Zytgloggeturm in Bern, das Schloss Chillon am Genfer See – und als Zugabe eine schillernde Postkarte, die je nach Betrachtungswinkel ihr Aussehen ändert: Im orangen Nichts schwebt oszillierend eine Scholle mit den Umrissen der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Der Titel dieser famosen Sammelaktion: ‹Suissemania›.
Heiligtum direkte Demokratie
Eine Manie ist nach dem Pschyrembel eine psychotische Störung der Affektivität, häufig mit Wahnvorstellungen und Katatonie verbunden. Man muss dies alles nicht als Diagnose der hiesigen Malaise lesen. Man muss nicht, aber man kann. Wie auf der Postkarte verliert das Land auch in der Wirklichkeit mehr und mehr jede erkennbare Kontur. Zerrüttet von den globalen Stürmen, sucht das Land Halt in nationalen Monumenten, die mittlerweile auf Miniaturgrösse geschrumpft sind, als Beifang des täglichen Konsums kostenlos abgegeben werden und problemlos in die persönliche Nippessammlung passen. Selbst der Werbespruch auf dem Umschlag scheint die hiesige Umnachtung aufzunehmen: ‹Mit vielen tollen Rätseln!›
Die Kräfte, die dieses Land im 21. Jahrhundert formen, werden derweil erfolgreich ignoriert. Wie Geister flössen sie den Menschen Angst ein und lähmen sie bis zur Katatonie. Keine der politischen Parteien hat den Mut, sich im Wahlkampf den realen Herausforderungen zu stellen. Dabei liegen sie meterhoch vor den Chalets des gebeutelten Heimatlandes, und es braucht enorme Verdrängungsleistungen, um an ihnen vorbeizusehen.
Am lautesten ist nach wie vor das Schweigen über das Verhältnis zur Europäischen Union. Die Situation ist einfach auch zu kompliziert: staatsrechtlich, diplomatisch und ökonomisch undurchschaubar und obendrein für jeden Politiker im Wahlkampf eine unerhörte Peinlichkeit. Wie soll er seinen Wählern auch erklären, was sie damals, am 9. Februar 2014, bei jener Abstimmung über die Masseneinwanderung, angerichtet haben? Und dass das Heiligste aller schweizerischen Heiligtümer, so himmelsgleich und gnadenreich, dass selbst die Spieledesigner es nicht gewagt haben, es in Plastik zu giessen, die direkte Demokratie nämlich, für diesen Unfall verantwortlich ist? Den nationalen Karren hat er so tief in den Dreck gefahren, dass keiner weiss, wie er jemals wieder befahrbaren Boden unter die Räder bekommen soll.
Was auf der Strecke bleibt
Europa ist auch im Herbst 2015 ein vergifteter Trank, von dem zu kosten sich selbst robuste Naturen nicht trauen. So hält man sich allenthalben an den Trost seiner Halluzinationen, schliesst die Augen und hofft, das Problem möge auf magische Weise von allein verschwinden. Keine erfolgreiche, aber dafür eine verbreitete Methode: Was riecht, wird auf den Balkon gehängt. So verpesten die zum Verlüften aufgehängten Kümmernisse mehr und mehr die Umgebung. Doch wer die Augen verschliesst, mag sich auch die Nase zuhalten, auch wenn ihm dann bald die Hände für eine vernünftige Arbeit fehlen.
Zu tun gäbe es genug. Die Schweiz hat seit 1990 das niedrigste Wirtschaftswachstum aller OECD-Länder. Ein Umstand, den man hier angeht, indem man Arbeitnehmer drangsaliert, Arbeitszeiten verlängert und Löhne kürzt. Die Linke und die Gewerkschaften, von denen man Protest erwarten könnte, verharren in einer über Generationen angelernten Bravheit, glauben immer noch an den Arbeitsfrieden und den Sozialvertrag und haben noch immer nicht verstanden, dass sie vom Melker zur Kuh geworden sind.
Die Exportwirtschaft ächzt unter dem starken Franken, aber man deutet die monetäre Folter zum Ertüchtigungsprogramm um, das in der gesundbeterischen Logik der ökonomischen Elite schliesslich dem gesamten Organismus zugutekommen wird. Weil sich höhere Angestellte gern beim Dauerlauf in Schwung halten, reden sie sich ein, auch eine Volkswirtschaft müsse ein wenig an die Grenzen gehen, um zu besseren Zeiten zu rennen. Was bleibt dabei auf der Strecke? Löhne, Steuern, Investitionen in Bildung und Forschung.
Hoffnung für die Wirtschaft kommt nur aus deutschen Exklaven und den grenznahen Gebieten jenseits des Rheins. Dort hat man sich auf die Verhältnisse eingestellt und neue, innovative Geschäftsmodelle entwickelt. Weil die Schweizer Konsumenten schneller als die Politik begriffen haben, dass man den starken Franken in diesen Zeiten besser hortet als ausgibt, kaufen sie ihre Ware gerne bei ausländischen Lieferanten im Internet. Die fakturieren glücklicherweise in Euro, also viel billiger. Und um gleich noch die Mehrwertsteuer zu sparen, lässt sich der helvetische Shopper das Paket an eine deutsche Adresse schicken. Und so erblüht das deutsche Jestetten, fast ganz von schweizerischem Territorium umgeben, im Zug der florierenden Paketdienste. Getränkehändler und Frisörsalons stellen ihre Postadressen preisbewussten Schweizern zur Verfügung, nehmen die Ware in Empfang, lagern sie treu, bis der Eigentümer sie auslöst. Die Autokolonnen am Wochenende und nach Feierabend nimmt man in Kauf. Schliesslich verdient man ordentlich. In Jestetten. Für die schweizerische Volkswirtschaft bedeutet der Einkaufstourismus im laufenden Jahr einen Schaden von elf Milliarden Franken.
Читать дальше