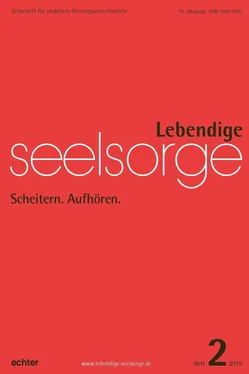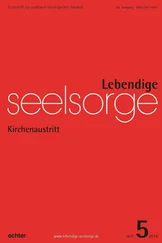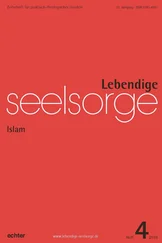Maria Elisabeth Aigner
Ao. Univ.-Professorin am Institut für Pastoraltheologie und Pastoralpsychologie an der Karl-Franzens-Universität Graz; Leiterin der Abteilung für Pastoralpsychologie; Lebens- und Sozialberaterin; Bibliodrama- und Bibliologtrainerin international; Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen an der Universität Graz.
Krisenphänomene erschüttern diese Seinsgewissheit in zweifacher Hinsicht. Zum einen sind sie Bestandteil jeder lebensgeschichtlichen Übergangssituation und haben mittlerweile auch im populärpsychologischen Sprachgebrauch Eingang gefunden: Pubertätskrisen, Ehe- oder Beziehungskrisen und der Pensionsschock gehören als Entwicklungskrisen zur Alltagserfahrung. Im verhaltenen oder offensiven Trubel und Chaos andauernder Identitätsfindungsprozesse macht sich aus dem Unterbewussten langsam ins Bewusstsein tretend die Erkenntnis breit, dass Veränderung ansteht. Etwas funktioniert im eigenen System und in Relation zur Umwelt nicht mehr so wie bisher. Die Krise signalisiert, dass es zu einem Wandel kommen wird. Es ist dies die Zeit, wo verfestigte Muster und Strukturen sich verflüssigen und der Stillstand aufgehoben wird.
Die Lebenserfahrung zeigt, dass Krisen- und Konfliktsituationen ein großes Potenzial beinhalten. Zugleich erleben Menschen diese Phasen mitunter äußerst schmerz- und leidvoll und trachten nach möglichst schneller Bewältigung, was einem heilsamen Entwicklungsprozess zumeist entgegensteht.
Zum anderen wird in sogenannten „Aktualkrisen“ (Rössler, 454) erfahren, dass die selbstverständliche und vertraute Routine des Lebens einen gewichtigen Einschnitt erfährt. Wenn die Krise nicht mehr allein ein verunsichernder, angstmachender, mit Schmerz verbundener Teil des Alltags ist, sondern sich wie ein Zusammenbruch anfühlt, der das Leben bis in die tiefsten Ritzen hinein erschüttert und infrage stellt, nimmt die Krisenerfahrung eine anders gelagerte Bedeutung an. Trennung, Tod, Verlust, Missbrauch, Krankheit, Ruin können Menschen so sehr zusetzen, dass es zu Traumatisierung, Störungen und totalem Rückzug kommt, der auch in einer suizidalen Krise enden kann, wenn die notwendigen Bewältigungs- und Copingstrategien nicht im hinreichenden Ausmaß vorhanden sind.
Die seelsorgliche Konnotation mit dem Begriff „scheitern“, sowie die Tatsache, dass das Scheitern größeren Endgültigkeitscharakter zu haben scheint als die Krise, verweisen auf die Schuldthematik und die Thematik der Schuldgefühle. Menschen erfahren sich gerade in Zusammenhang mit der Erfahrung von Scheitern in Schuld verstrickt oder werden von Schuldgefühlen geplagt, der bewussten oder unbewussten Überzeugung also, etwas Falsches getan zu haben, was womöglich gar nicht der Fall ist. Es gibt Anteile von Selbst- und Fremdverschulden im Scheitern und selten lassen sich diese klar benennen – weder von Seiten der Betroffenen noch von außen.
Das Erleiden-, Erdulden-, Ertragen-Müssen erzeugt Ohnmacht. Schuldgefühle stellen eine erahnte Möglichkeit dar, für das Geschehene Verantwortung zu übernehmen und sich dadurch nicht mehr so entsetzlich ohnmächtig zu fühlen. Scheitern hat mit Versagen, Niederlagen, Begrenzungen, Scham, sowie mit dem Gefühl des Ausgeliefert-Seins zu tun – allesamt Tabus in einer leistungsorientierten Gesellschaft.
Vor diesem Hintergrund ist das Einsetzen jeglicher Chancenrhetorik im Zusammenhang mit Krisen und Scheitern mit Vorsicht zu genießen. In den Erschütterungsprozessen der Seinsgewissheit auch ungeahnte Chancen zu wittern, kann fatal und notwendig zugleich sein. Es ist fatal und grenzt an Zynismus, dem Gescheiterten in seinem Elend vorschnell mit der Hoffnung, oder mit Potenzialen und Chancen zu kommen. Die Chancen aufzuzeigen ist dennoch wichtig, weil das Wissen, dass im Prozess des Scheiterns auch die Möglichkeit des Eintauchens in eine neue Kehre des Lebens – der Umkehr – liegt, Mut machen kann, nicht aufzugeben. Dem Schicksal des Scheiterns nicht zu erliegen, sondern in ihm in paradoxer Weise den Keim des Neubeginns zu erahnen, dazu gehören Vertrauen ins Leben und Lebenskunst.
In den Erschütterungsprozessen der Seinsgewissheit auch ungeahnte Chancen zu wittern, kann fatal und notwendig zugleich sein.
HÖR AUF (MICH)!
Kinder wissen noch am besten, wie mit Scheitern umgegangen werden kann, denn sie erproben sich spielerisch im Experiment, das das Scheitern mit einschließt. Immer wieder scheitert das Gehen im Probieren der ersten Schritte des Kleinkindes, weil es hinfällt. Und erneut steht es unermüdlich auf, bis die Füße von selber in der aufrechten Fortbewegung tragen. Der kindliche Entdeckungs- und Erkundungssinn und das Wiederholen kennen mitunter keine Grenzen – auch wenn Gefahr droht. „Hör auf!“ ist dann das Signal aus dem Mund der Erwachsenen, um zu verdeutlichen, dass es nun genug ist. „Hör damit auf!“, lautet der Appel, der zugleich suggeriert: „Hör auf mich, ich sage dir, was gut für dich ist!“. Aufhören geschieht, weil wir auf etwas hören – auf die Stimme der Mutter oder auf unsere eigene innere Stimme, die so wie andere Menschen, auf die wir hören, zu uns gehört.
Aufhören hat ähnlich wie das Scheitern etwas mit Grenzerfahrung zu tun. Das Aufhören markiert selbst die Grenze. Das, was war, ist nicht mehr – es wurde beendet. Es gibt einen Bruch, ein Zerschellen der Kontinuität an der Entscheidung, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Die Distanz zum Vorhergehenden kann als schmerzlicher Verlust oder aber auch als befreiende Erleichterung wahrgenommen werden. Die Distanz zu dem, was kommen wird, birgt einen hohen Grad an Verunsicherung in sich. Aufhören, beenden, beschließen heißt in einem ersten Schritt, die Leere auszuhalten, es sei denn, diese Leerstelle wird nicht sofort mit neuer Aktivität aufgefüllt. Es gibt das Aufhören als aktiven Beschluss, aber auch als resigniertes klein Beigeben. Mit etwas bewusst aufzuhören und Schluss zu machen, bedroht, besticht, verunsichert und verletzt, oder es schafft Raum, ermöglicht, erfreut, bereichert.
In diesem Sinne bedeutet Aufhören auch, sich einer bestimmten Ambivalenz auszusetzen. Die Ambivalenz trifft jene, die den Akt des Aufhörens vollziehen, aber auch jene, die passiv davon betroffen sind. Denn einerseits heißt Aufhören oder Beenden, dass etwas Neues entstehen kann, andererseits stirbt etwas Altes. Die eine Seite verlangt, das Alte gehen zu lassen, die andere, sich dem Neuen in einem intensiven Prozess zu öffnen.
Wenn der Schnitt gesetzt wird, ist noch nicht klar, in welche Richtung es sich entwickelt: Kann der Verlust ausgehalten und betrauert werden? Bleibt er eine klaffende Wunde, die sich erst nach langer Zeit schließen wird? Ist das Beendete unwiderruflich beendet oder kann wieder damit „angefangen“ werden? Wird das neu Entstehende wahrgenommen und erkannt, lässt es sich mutig gestalten?
Wie grausam sich der Schnitt des Aufhörens anfühlen kann, ist in Mt 18,8-9 verdeutlicht: „Wenn dir deine Hand oder dein Fuß Ärgernis gibt, dann hau sie ab und wirf sie weg! Es ist besser für dich, verstümmelt oder lahm in das Leben zu gelangen, als mit zwei Händen und zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dir dein Auge Ärgernis gibt, dann reiß es aus! Es ist besser für dich, einäugig in das Leben zu kommen, als mit zwei Augen in das Feuer der Hölle geworfen zu werden.“ Der Preis ist hoch, der Gewinn mächtig: Es geht darum, ins Leben zu kommen und das, was daran hindert, dem Feuer preiszugeben, auch wenn es in einer solchen Nähe zu uns steht wie unser eigener Augapfel.
DAS GESCHENK DES LEBENS
Einfach da zu sein, sich dem Leben ohne viel Aufhebens hingeben zu können und darauf zu vertrauen, dass es durch die Tage und Wochen hindurch trägt, ist möglich durch die unhinterfragte Gewissheit, zu existieren. Krisen und Scheitern bringen Ungewissheit, die vertraute Selbstverständlichkeit der Gewissheit gerät ins Wanken. Dieser Lebensungewissheit und der damit verbundenen tiefen Verunsicherung versucht die Seelsorge etwas entgegenzusetzen, das bestärkt und Empowerment bedeutet. Die Pastoralpsychologie verwendet dafür den Begriff „Lebensvergewisserung“ und meint damit „[…] den Prozess, zu lernen, auf das Leben zu vertrauen“ (Weiß, 50).
Читать дальше