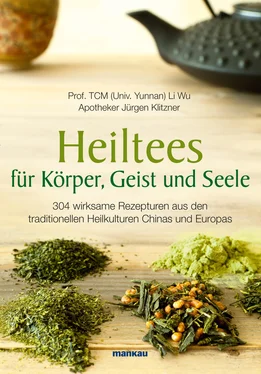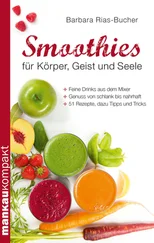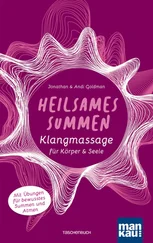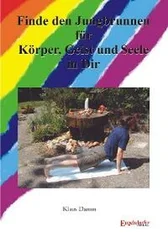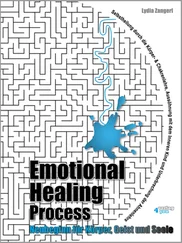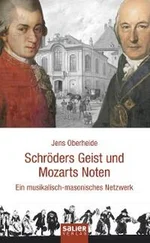Eines der ältesten medizinischen Schriftstücke stammt aus dem Alten Ägypten. Es ist der sogenannte Papyrus Ebers. Die etwa 1600 v. Chr. verfassten Papyrusrollen beinhalten Beschreibungen von Krankheiten sowie 700 tierische und pflanzliche Wirkstoffe, mit denen die Beschwerden, zum Beispiel Verletzungen oder Zahnschmerzen, bekämpft werden sollten. Außerdem wurden offenbar schon Knoblauch und Zwiebeln genutzt, um den Ausbruch von Infektionskrankheiten beim Bau der Pyramiden zu vermeiden.
Von der Antike bis zur Epoche der Klostermedizin
Für den westlich-europäischen Kulturkreis ist vor allem Hippokrates (460 v. Chr. bis 370 v. Chr.) hervorzuheben. Er sah im Ungleichgewicht von Körpersäften die Ursache vieler Leiden. Seine »Viersäftelehre« (Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle) wurde später von Galenus von Pergamon (129 bis ca. 200 n. Chr.), dem griechischen Leibarzt des römischen Kaisers Marc Aurel, weiterentwickelt. Auch dessen Lehre beruhte auf der hippokratischen Annahme, dass Feuer, Erde, Luft und Wasser die Grundelemente allen Seins darstellen. Den vier Säften ordnete er die vier Qualitäten warm, trocken, feucht und kalt zu. Schleim galt zum Beispiel als feucht und kalt. Ob man nun gesund oder krank war, hing vom Gleichgewicht der Elemente ab. Nach diesem Prinzip schrieb er auch jeder Heilpflanze bestimmte Qualitäten zu. Eine Krankheit, die durch Kälte verursacht wurde, sollte also mit einer Pflanze bekämpft werden, die Wärme im Körper erzeugt.
Das erste umfangreiche europäische Heilpflanzenbuch verfasste der griechische Arzt Pedanios Dioskurides (1. Jahrhundert n. Chr. ) mit der fünfbändigen »De Materia medica« im Jahr 60 n. Chr. In seinem Werk beschrieb er ausführlich Art und Wirkung von über 600 Kräutern. Damit blieb es ein Standardwerk bis ins 17. Jahrhundert hinein. Kurz nach Dioskurides schrieb der römische Gelehrte Plinius der Ältere (23 bis 79 n. Chr.) seine »Naturalis Historia«, in der zahlreiche Kapitel über die Bedeutung der Pflanzen und über pflanzliche Heilmittel zu finden sind. Bis heute wegweisend war auch die erste systematische Pflanzenbeschreibung, die deren Herkunft, ihre botanische Klassifizierung, Eigenschaften, Zubereitung und Anwendung umfasst.
In den folgenden Jahrhunderten entwickelte sich die Pflanzenkunde insbesondere in den Klöstern weiter. Mönche und Nonnen sammelten das Wissen der Ägypter, Griechen, Kelten und Germanen und fügten Volksweisheiten und eigene Erkenntnisse über die Heilwirkung von Kräutern und Heilpflanzen hinzu. Die Klostermedizin, die zwischen dem 8. und 13. Jahrhundert angesiedelt wird, stellt eine eigene Epoche in der Medizingeschichte dar. In dieser Phase vom Früh- bis zum Hochmittelalter wurden die Menschen in Europa ausschließlich von Mönchen und Nonnen medizinisch versorgt. Außerhalb der Klöster war es schwierig bis unmöglich, sich die notwendigen medizinischen Kenntnisse anzueignen, um als Arzt arbeiten und heilen zu können. Anders in den Klöstern. Eine große Rolle spielten dabei die Klostergärten, die im sogenannten St. Gallener Klosterplan von Karl dem Großen um 820 n. Chr. angeordnet worden waren. Hier wurde genau festgelegt, welche Heilpflanzen in den Gärten herangezogen werden sollten. Unter anderem gehörten dazu Salbei, Wermut, Fenchel, Schlafmohn, Liebstöckl, Kerbel, Flohkraut, Betonie, Rettich und Minze.

In mittelalterlichen Kräuterbüchern werden Samen und Saft des Schlafmohns als Heilmittel u.a. bei Schlafstörungen, Entzündungen, Husten, Gicht und Menstruationsbeschwerden empfohlen.
Ein wichtiges Dokument aus dem 8. Jahrhundert mag Karl den Großen bei seiner Gartenanordnung beeinflusst haben. Das »Lorscher Arzneibuch« eines Mönchs im Kloster Lorsch enthält hauptsächlich Rezeptsammlungen aus Kräutern und anderen Pflanzen. Etwa 200 Jahre später verfasst der Mönch Odo Magdunensis das Werk »Macer floridus«, das mit seinen 80 Heilpflanzen zum Standardwerk für ganz Europa wurde.
Eine herausragende Rolle nahm die Benediktinerin Hildegard von Bingen (1098–1179) ein. Ihre damalige Popularität ist nicht vergleichbar mit der heutigen Präsenz. Aber durch ihre Schriften verbreitete sich die Kräuterkunde in weiten Teilen der Bevölkerung – und hat Anhänger bis heute. Mit ihrem in lateinischer Sprache verfassten »Buch über das innere Wesen der verschiedenen Kreaturen und Pflanzen« brachte sie nicht nur die lateinisch-griechische Heiltradition mit der volkstümlichen Heiltradition zusammen, sie schuf damit auch ein wichtiges Rezeptionswerk für die Pflanzenheilkunde. Die sogenannte Hildegard-Medizin basiert auf fünf Säulen: seelisches Gleichgewicht, feste Lebensregeln, gesunde Ernährung, Naturheilmittel und Ausleitungsverfahren. Zu den Naturheilmitteln gehören zwar auch Edelsteine und Mineralien, aber vor allem Pflanzen. Als besonders heilkräftig empfahl sie Brennnessel, Mariendistel, Schafgarbe, Galgant, Ringelblume, Ingwer.
Im Jahr 1485 erschien das Werk »Gart der Gesundheit«. Der Frankfurter Arzt Wonnecke von Kaub stellte in 435 Kapiteln insgesamt 382 Pflanzen vor. Der »Gart« wurde noch sechzigmal nachgedruckt und diente bis ins 16. Jahrhundert als Basis für andere Kräuterabhandlungen.
In den Jahrhunderten danach fanden weltliche Heiler und nichtkirchliche Apotheken immer mehr Zuspruch, sodass die Klöster zum Teil an Bedeutung verloren. Erschwerend kam hinzu, dass die Reformation zur Aufhebung und Schließung zahlreicher Klöster führte.
Die Ausbildung der Mediziner fand nun vermehrt an den Universitäten statt. Aber auch hier gerieten die medizinischen Lehren aus den Klöstern nicht in Vergessenheit. Der Arzt, Alchemist und Philosoph Paracelsus (ca. 1493 bis 1541) nutzte die Heil- und Pflanzenlehre der Hildegard von Bingen – auch wenn sein Grundverständnis der Ursachen von Krankheiten ganz anderer Natur war. Er griff auf die Signaturenlehre zurück, die schon bei den Naturvölkern eine entscheidende Rolle spielte und im Mittelalter zur klassischen medizinischen Ausbildung gehörte. Demnach seien die äußere Erscheinung und Gestalt einer Pflanze, ihr Geruch und ihre Farbe Zeichen, »Signaturen«, die auf die heilende Kraft hinweisen würden. So habe die Bohne eine heilende Wirkung auf die Nieren oder die Walnuss eigne sich für die Behandlung von Beschwerden im Gehirn.
In der folgenden Zeit begann sich das Ringen zwischen der alternativen und der wissenschaftlichen Medizin schon abzuzeichnen, auch wenn die Kräuterheilkunde weiterhin fester Bestandteil der Arzneikunde blieb.
Ab dem 19. Jahrhundert entwickelte sich im Zuge der Industrialisierung die sogenannte Schulmedizin. Neue wissenschaftliche Erkenntnisse in Biologie, Chemie und Pharmazie drängten die Pflanzenheilkunde in den Hintergrund. Doch trotz des unbestreitbaren Segens, den die medizinische Entwicklung mit sich brachte, wurde den Menschen bewusst, dass die chemischen Heilmethoden auch Nachteile mit sich brachten. Viele besannen sich wieder auf die traditionelle Wirkkraft der Pflanzen.

Heilkräuter – die gesunde Alternative
Heute kann man fast von einem Boom der alternativen Heilmethoden sprechen. Rund 12.000 Heilpflanzen sind weltweit bekannt. Pflanzenwirkstoffe in niedrig- und hochdosierter Form sind überall erhältlich und die Absatzzahlen sprechen für sich.
Viele Patienten vertrauen auf die pflanzlichen Heilmethoden und sehen in ihnen eine schonende, natürliche Behandlungsmethode. Die Natur scheint auf den Menschen mit seinen verschiedensten Unpässlichkeiten vorbereitet zu sein. Auf der ganzen Welt gibt es Blumen, Sträucher und Bäume, deren Blüten, Blätter, Wurzeln und Stängel Heilung bewirken können.
Читать дальше