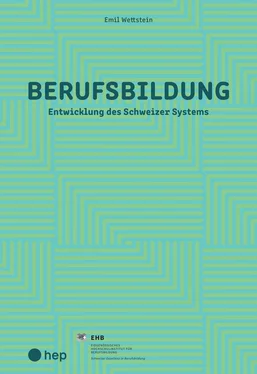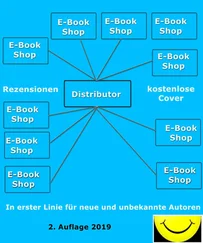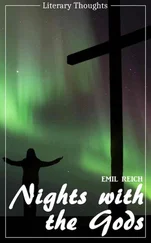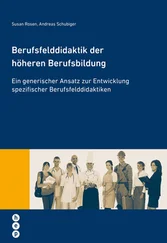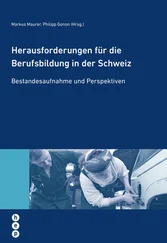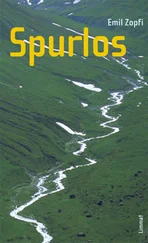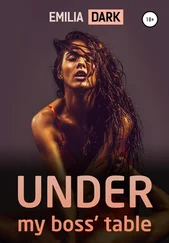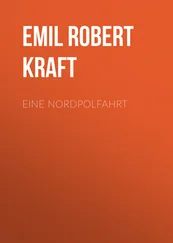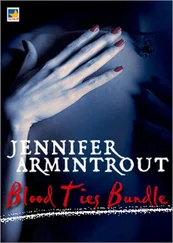Fehlt es an Arbeitskräften, liegt es nahe, sie im Ausland zu suchen, zumal die Schweiz im ganzen 20. Jh. ein vergleichsweise attraktiver Arbeitsort darstellt. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind es in erster Linie Italienerinnen und Italiener, die angeworben werden. Die meisten sind ungelernt, viele haben die Volksschule – wenn überhaupt – nur fünf Jahre besucht. Italienische Emigrationsorganisationen entwickeln in der Schweiz ein eigenes, für italienische Arbeiterinnen und Arbeiter bestimmtes Weiterbildungsprogramm, umfassend berufsorientierte und allgemeinbildende Kurse, später auch Programme zur Integration der zweiten Generation – erste Massnahmen im Rahmen der interkulturellen Pädagogik.
Vergleiche dazu Kapitel 32, Berufsbildung für Migrant/-innen
Die Förderung der Weiterbildung durch den Bund begann aber nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern wie diejenige der Grundbildung 1884. Gefördert wurde damals die Weiterbildung durch «Wandervorträge», in denen Neuerungen wie die Anwendung von elektrischem Strom oder neue Düngemethoden vorgestellt wurden. Gefördert wurden zudem Periodika mit berufskundlichen Beiträgen und die «Modell- und Mustersammlungen», in denen Handwerker anhand von «Mustern» aus dem Ausland Anregungen für die Verbesserung der eigenen Produkte finden konnten. Diese Sammlungen entwickeln sich zu Gewerbemuseen weiter, einige später zu Kunstgewerbemuseen und dann zu Museen für Gestaltung.
Gewerbemuseen sind Thema von Kapitel 20
Erste Revision des Berufsbildungsgesetzes
Mitte der 1950er-Jahre wird von verschiedenen Seiten darauf hingewiesen, dass das 1930 erlassene Gesetz veraltet sei. Es regle nur die berufliche Ausbildung, von Weiterbildung sei nur am Rande die Rede.
1958 wird eine Kommission eingesetzt, die das 1930 erlassene Gesetz revidieren soll. Sie wird von Fürsprecher Hans Dellsperger geleitet, der im gleichen Jahr die Leitung der Abteilung Berufsbildung im BIGA übernommen hat. Der 1962 vorgelegte Entwurf enthält gemäss allgemeiner Meinung nicht allzu viel Neues. Immerhin ermöglicht die 1963 verabschiedete Version eine stärkere Förderung der Weiterbildung und bringt die Umbenennung der Techniken in «Höhere Technische Lehranstalten», deren Absolventen sich nun «Ingenieur-Techniker HTL» nennen können. Weitere wichtige Neuerungen sind gemäss Bundesrat die Regelung der Berufsberatung und die Aufwertung der Berufsschule.
Mehr zum BBG 1963 in Kapitel 06, zur Berufsberatung in Kapitel 33, zu den Berufsschulen in Kapitel 22
Die Notwendigkeit des Ausbaus und der Systematisierung der Vorbereitung von Lehrpersonen an Berufsschulen wird seit den 1880er-Jahren diskutiert. Immer wieder finden einzelne Kurse für Lehrpersonen statt.
1972 geht es nun einen grossen Schritt weiter: Im Frühjahr beschliesst der Bundesrat die Gründung des «Schweizerischen Instituts für Berufspädagogik» (SIBP) als Sitz und verantwortliche Stelle für die Aus- und Weiterbildung dieser Lehrpersonen, für die Führung einer Dokumentationsstelle und für die Forschung zum beruflichen Unterricht. Im Oktober beginnen bereits die ersten Studiengänge für Lehrpersonen von Berufsschulen, vorerst in gemieteten Räumen und einem «hölzernen Pavillon» (d. h. einer Baracke!) in Bern-Wankdorf. Im Jahr darauf wird eine französischsprachige Abteilung in Lausanne gegründet, und ab 1979 finden im Tessin italienischsprachige Kurse statt.

Abbildung 9Der Hautpsitz des Schweizerischen Instituts für Berufspädagogik, dem heutigen Eidgenössischen Hochschulinstitut für Berufsbildung, konnte 1986 einen repräsentativen Neubau in Zollikofen (BE) beziehen (G. Herzog und EHB)
1986 kann der Hauptsitz von Bern in einen repräsentativen Neubau in Zollikofen zügeln. 2007 wird aus dem SIBP das «Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung» (EHB). Inzwischen ist das Arbeitsfeld auf alle Bereiche der Berufsbildung ausgeweitet worden, sowohl bezüglich der Ausbildung als auch der Forschung. (Lustenberger 2010)
Die Qualifizierung der Lehrpersonen ist auch Thema des Kapitels 24
Das EHB hat aber auch Konkurrenz bekommen: Verschiedene Pädagogische Hochschulen bilden ebenfalls Lehrpersonen für die Berufsschulen aus, ergänzend zur Ausbildung von Handelslehrerinnen und -lehrern an mehreren Universitäten.
Im Oktober 1957 schiesst die Sowjetunion überraschend einen Satelliten ins All und beweist damit, dass sie technisch leistungsfähiger ist, als der Westen annahm. («Sputnikschock»). Der Westen leitet eine Aufholjagd ein, an der sich auch die Schweiz beteiligt. Die MEM-Industrie verlangt eine Verdopplung der Ausbildungsplätze für Techniker und Ingenieure. Die «Begabtenförderung» wird zum Anliegen der Bildungspolitik, wobei darunter in erster Linie die Förderung des Mittel- und Hochschulbesuchs verstanden wird. In den 1960er-Jahren entstehen im Rahmen dieser Bemühungen neue Mittelschulen, aber auch neue Technika zur Weiterbildung von Berufsleuten, darunter auch Abendtechnika und ein landwirtschaftliches Technikum.
Wovon ist die Rede?
Mittelschulen sind Schulen in der Sekundarstufe II. Die bekanntesten Mittelschulen sind die Gymnasien. Weitere sind insbesondere Handelsmittelschulen, Fachmittelschulen, Berufsmittelschulen. Sie bereiten auf Hochschulen vor, weshalb sie auch als Maturitätsschulen bezeichnet werden. Sie können aber auch doppelqualifizierend sein, also sowohl auf das Erwerbsleben wie auf ein Studium vorbereiten.
Die im 19. Jh. üblichen Industrie-, Handels- und Kunstschulen umfassten oft zwei Stufen, die wir heute (wie die Langzeitgymnasien) zu Sekundarstufe I bzw. Sekundarstufe II zählen würden. Vgl. auch [Mittelschulen] im Materialienband.
Die Bestrebungen sind erfolgreich: In den 1960er-Jahren verdoppelt sich sowohl die Zahl der Maturitäten (1960 sind es 3105, 1970 bereits 5959) als auch die Zahl der Studierenden an den Schweizer Hochschulen. Der Drang an die Gymnasien stösst bei den Gymnasiallehrern nicht nur auf Begeisterung, denn ihre Schülerschaft verändert sich. Dies führt dazu, dass eine Studiengruppe von Gymnasiallehrern 1967 einen neuen, weniger anspruchsvollen Typ von Mittelschulen vorschlägt, die «Schule für mittleres Kader». [1967g; 1968c]
Auch der Anteil an Jugendlichen, die in eine Berufslehre eintreten, wächst. Von den leistungsfähigsten wandert ein Teil an die Mittelschulen ab. «Die Qualität der Lehrlinge hat sich wesentlich verschlechtert», stellt H. Dellsberger, Sektionschef BIGA, fest. [1968g]
Bereits 1968, im Anschluss an die Präsentation der Schule für mittleres Kader, gibt das BIGA grünes Licht für einen Pilotversuch mit einem Zug mit mehr Allgemeinbildung, genannt «Berufsmittelschule» (BMS). Sie soll die Berufslehre wieder attraktiv für leistungsstarke Jugendliche machen und damit die Abwanderung in die Mittelschulen bremsen. Noch im gleichen Jahr nehmen an der Gewerbeschule Aarau und der Berufsschule BBC in Baden die ersten Berufsmittelschulen ihren Betrieb auf. Ein Jahr darauf ziehen Bern und Zürich nach. Die neuen Schulen sind für die «besten 5 Prozent der Lehrlinge» bestimmt und vermitteln ihnen an einem Tag pro Woche zusätzlichen allgemeinbildenden Unterricht.
Den Initianten geht es in erster Linie um vertiefte Allgemeinbildung. In Absprache mit regionalen HTL erreichen sie aber bald, dass erfolgreiche Absolventen der Berufsmittelschulen von der Aufnahmeprüfung in die HTL befreit werden. Ersten informellen Absprachen folgt 1975 eine Vereinbarung von sechs Kantonen mit verschiedenen HTL, die den prüfungsfreien Übertritt regelt.
Читать дальше