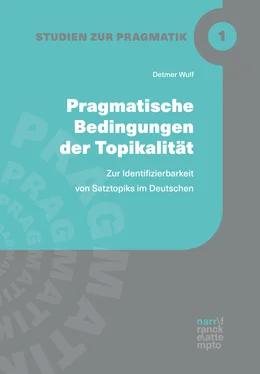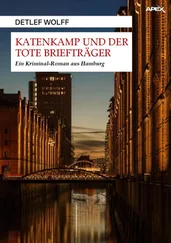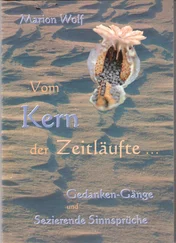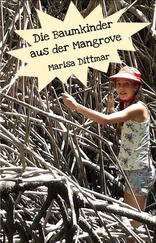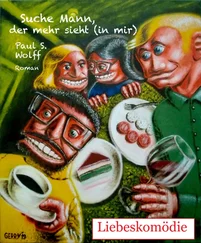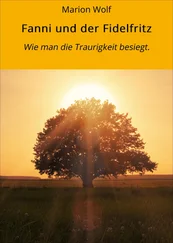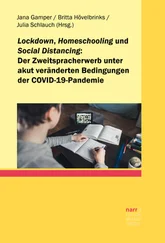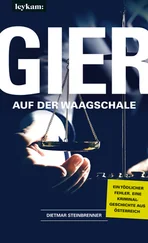Die oben diskutierten Beispiele, in denen das Topik immer durch das Subjekt-Argument repräsentiert wird, erwecken vielleicht zunächst den Eindruck, dass Strawson das Subjekt generell als Indikator für Topikalität begreifen möchte. Diese Auffassung kann ihm jedoch nicht zugeschrieben werden, wie die folgenden Beispiele zeigen (vgl. 1971a, 96):
| (2a) |
A: What examples are there of famous contemporary figures who are bald? B: The king of France is bald. |
| (2b) |
A: What outstanding events, if any, have occurred recently in the social or political field? B: The king of France married again. |
Beiden Antworten lässt sich Strawson zufolge ein Wahrheitswert zuordnen. Sie sind als falsch beurteilbar, trotz des von ‚reference-failure‘ betroffenen Subjekt-Ausdrucks. Diesen Befund führt er auf den jeweils vorausgesetzten Fragekontext zurück: „The question in each case represents the antecedent center of interest as a certain class“ (1971a, 96). Die Antwort in (2a) möchte Strawson darum als eine Behauptung über die in der Frage erwähnte Klasse kahlköpfiger Berühmtheiten deuten, zu der auch ein gegenwärtiger König von Frankreich gehören soll. Da dies nicht der Fall sein kann, lässt sich die Antwort von B als falsche Antwort auf die Frage nach gegenwärtigen kahlköpfigen Berühmtheiten auffassen. Auch die Antwort in (2b) lässt sich laut Strawson durch den Fragekontext als falsch deuten: Dort wird behauptet, dass ein bestimmtes Ereignis stattgefunden hat: nämlich die Heirat des (gegenwärtigen) Königs von Frankreich – was ebenfalls nicht der Fall gewesen sein kann.4
Strawson hat den Topik-Begriff in die Diskussion um referenztheoretische Fragen eingebracht, um darauf hinzuweisen, dass bei der Frage nach der Zuweisbarkeit von Wahrheitswerten auch die kommunikative Rolle der in den Behauptungsäußerungen genannten Diskursgegenstände zu berücksichtigen ist – und damit der diskursive Kontext, in den die Äußerungen jeweils eingebettet sind. Dass eine Frage wie die, ob es zutrifft, dass Johns Kinder schlafen, schlicht „nicht aufkommt“ ( does not arise ), wenn John gar keine Kinder hat (vgl. das oben angeführte Beispiel), erklärt sich einfach daraus, dass kein Äußerungskontext vorstellbar ist, in dem sich eine solche Frage sinnvoll stellen ließe. Denn dass ein Diskursgegenstand – wie etwa Johns Kinder – im Rahmen eines Frage-Antwort-Kontexts als „center of current interest“ gelten kann, setzt voraus, dass für diesen Gegenstand seitens des Sprechers und Hörers das vorliegt, was Strawson Identifizierungswissen nennt. Auf diesem Umstand beruht nicht nur Strawsons Intuition, dass Topiks Teil dessen sein müssen, was sprecher- und hörerseitig präsupponiert wird, sondern auch seine Einsicht, dass eine Behauptung wie etwa die, dass Johns Kinder schlafen, erst durch ihre In-Beziehung-Setzung zu einem aktuellen „center of interest“ Informativität erhält:
We do not, except in social desperation, direct isolated and unconnected pieces of information at each other, but on the contrary intend in general to give or add information about what is a matter of standing or current interest or concern. (1971a, 97)
In diesen Zusammenhang ist Strawsons ‚principle of relevance‘ zu stellen, das er seinem ‚principle of the presumption of knowledge‘ als Komplementärprinzip zur Seite stellt (vgl. 1971a, 97f.): Eine Behauptungsäußerung ist nicht nur allein dadurch informativ, dass sie dem Hörer etwas Neues mitteilt ( presumption of ignorance ), sondern auch dadurch, dass die neue Information auf den Diskursgegenstand zu beziehen ist, der als „center of interest“ aktuell die Topik-Rolle innehat.
3.2 Reinhart: Topiks als „referential entries“
Strawsons Explikation der Aboutness-Relation als Relation zwischen Äußerung und im Diskurs verankertem „center of current interest“ erfährt bei T. Reinhart eine kognitive Deutung (vgl. Reinhart 1981). Hierfür greift sie zunächst auf seine Diskussion der kommunikativen Voraussetzungen für die Beurteilbarkeit der Wahrheitswerte von Behauptungsäußerungen zurück. Strawsons Einsicht, dass die Beurteilbarkeit assertiver Äußerungen hinsichtlich ihrer Wahrheit oder Falschheit zu einem nicht geringen Umfang auch Topik-gesteuert ist, reformuliert Reinhart folgendermaßen:
[…] the selection of a topic for a given assertion in a given context may be viewed as a selection among the various ways to assess it – it will be verified by checking what we know about the topic. (Reinhart 1981, 60)
Angewendet auf eines der Beispiele Strawsons lassen sich Reinharts Ausführungen folgendermaßen verstehen: Wenn beispielsweise über eine aktuelle Ausstellung ausgesagt wird, dass sie von einer bestimmten Person besucht worden ist, dann wird im Fall einer Einschätzung ( assessment ) des Wahrheitsgehalts dieser Behauptung in aller Regel auf Wissensbestände über die Ausstellung zurückgegriffen, etwa ob für die Ausstellung tatsächlich zutrifft, dass sie von der in Rede stehenden Person besucht worden ist – und eher nicht auf Wissen über die Person, etwa ob zutrifft, dass sie die Ausstellung besucht hat. Kurz: Einschätzungen des Wahrheitsgehalts von Behauptungen sind nach Reinhart immer zu verstehen als Einschätzungen des Wahrheitsgehalts von Behauptungen über ein Topik.1
Hierauf beruht Reinharts Verständnis pragmatischer Aboutness. Aboutness ist als Mittel zur Organisation und Strukturierung des Diskursverlaufs zu verstehen. Mit Stalnaker (1978) begreift sie Diskurse als Prozesse der Anreicherung von Information, die Sprechern und Hörern im weiteren Verlauf des Diskurses als gemeinsames propositionales Wissen zur Verfügung steht, auf das ggf. zurückgegriffen werden kann und das somit als sprecher- und hörerseitig bekannt vorausgesetzt (präsupponiert) werden kann. Die im Diskurs zu einem gegebenen Zeitpunkt angesammelte ‚Menge‘ der (als bekannt vorausgesetzten) Propositionen nennt Reinhart unter Rückgriff auf Stalnaker „context set“:
[…] the context set of a given discourse at a given point [is] the set of the propositions which we accept to be true at this point. […] The effect of each new assertion in a discourse is to add the proposition expressed by it to the presuppositions in the context set. A discourse can be described, then, as a joint-procedure of constructing a context set. (Reinhart 1981, 78f.)
Reinhart stellt heraus, dass die im ‚context set‘ angesammelte Information nicht als unverbundene Aneinanderreihung isolierter Propositionen zu verstehen ist. Vielmehr kommt es im Diskursverlauf zu einer Strukturierung und In-Beziehung-Setzung der Einzelpropositionen, um die Verarbeitung neu hinzukommender Information zu erleichtern. Wie diese Verarbeitung vor sich gehen soll, veranschaulicht sie anhand einer Metapher: Die Menge der im ‚context set‘ enthaltenen Propositionen ist in der Art eines Schlagwort-Katalogs ( subject catalogue ) einer Bibliothek organisiert. Die Organisation der zum ‚context set‘ neu hinzukommenden Information geschieht dabei auf der Basis zweier kognitiver Strukturierungsprinzipien. Neu hinzukommende Information wird immer im Hinblick auf ein Topik bewertet ( assessment ) und im Anschluss als Information über dieses Topik abgespeichert ( storage ): „Assess by what you already know about the topic, store under an entry corresponding to this topic“ (Reinhart 1981, 80). Vor dem Hintergrund ihrer Katalog-Metapher lässt sich Reinharts Topik-Begriff somit folgendermaßen verstehen: Topiks fungieren als kognitive ‚Adresse‘ für die in den Propositionen enthaltene (neue) Information. 2 Sie sind der Ort, unter dem die jeweils neu hinzugekommene Information abgelegt wird:
The propositions admitted into the context set are classified into subsets of propositions, which are stored under defining entries. At least some such entries are defined by NP-interpretations. NP sentence-topics, then, will be referential entries under which we classify propositions in the context set and the propositions under such entries in the context set represent what we know about them in this set. (Reinhart 1981, 80)
Читать дальше