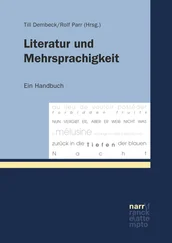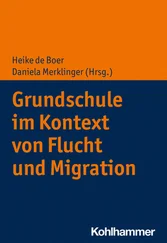Simonek, Stefan (2016). Von Lenau zu „Laibach“: Beiträge zu einer Kulturgeschichte Mitteleuropas (= Wechselwirkungen 18). Frankfurt am Main, Wien: Peter Lang.
Stippinger, Christa (2009). „vom schreiben der expatriatrii“: zur literatur von autorinnen mit migrationshintergrund in österreich am beispiel der exilliteraturpreise schreiben zwischen den kulturen . In: Mitterer, Nicola/Wintersteiner, Werner (Hrsg.). Und (k)ein Wort Deutsch … Literaturen der Minderheiten und MigrantInnen in Österreich (= Schriftenreihe Literatur 23). Wien, Innsbruck: Studien-Verlag, 106–114.
Strutz, Johann (2003). Regionalität und Interkulturalität. Prolegomena zu einer literarischen Komparatistik der Alpen-Adria-Region. Habilitationsschrift. Klagenfurt/Celovec.
Strutz, Johann/Zima, Peter V. (Hrsg.) (1996). Literarische Polyphonie: Übersetzung und Mehrsprachigkeit in der Literatur. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
Uhl, Heidemarie (2001). Das „erste Opfer“: Der österreichische Opfermythos und seine Transformationen in der Zweiten Republik. Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft 1, 19–34. Abrufbar unter: https://webapp.uibk.ac.at/ojs/index.php/OEZP/article/view/1054/749(Stand: 22/12/2018)
Wintersteiner, Werner (2006). Poetik der Verschiedenheit. Literatur, Bildung, Globalisierung. Klagenfurt/Celovec: Drava.
Wytrzens, Günther (2009). Slawische Literaturen – Österreichische Literatur(en). Herausgegeben von Fedor B. Poljakov und Stefan Simonek (= Wechselwirkungen 12). Bern u.a.: Peter Lang.
Zadravec, Franc (1999). Slovenska književnost II. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Zeyringer, Klaus (1995). Literaturgeschichte als Organisation: Zum Konzept einer Literaturgeschichte Österreichs. In: Schmidt-Dengler, Wendelin/Sonnleitner, Johann/Zeyringer, Klaus (Hrsg.). Literaturgeschichte: Österreich: Prolegomena und Fallstudien. Berlin: Schmidt, 43–52.
Zeyringer, Klaus/Gollner, Helmut (2012). Eine Literaturgeschichte: Österreich seit 1650. Innsbruck, Wien, Bozen: StudienVerlag.
Žitnik Serafin, Janja (2008). Večkulturna Slovenija: Položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru (= Migracije 15). Ljubljana: ZRC, ZRC SAZU.
Žitnik, Janja (Hrsg.) (1999). Slovenska izseljenska književnost 1–3. Unter Mitarbeit von Helga Glušič. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Žitnik, Janja/Glušič, Helga (Hrsg.) (1999). Slovenska izseljenska književnost. 3 Bände. Ljubljana: ZRC/Rokus.
Ein- und Mehrsprachigkeit literarischer Systeme
Marko Juvan (Ljubljana)
Abstract:Drawing on YildizYildiz, Yasemin’s recent book on multilingualism and BeecroftBeecroft, Alexander’s work on the ecology of world literature, the present study focuses on the tendency of the social system of literature to reduce multilingualism in favour of either a single mother tongue (‘national’ literary language within national literary systems) or a single world language (within the world literary system). Whereas world literature initially evolves as a multilingual and autonomous system that is believed to transcend national literatures because of its universal values, particular national literatures fashion their individuality in the international space and having regard to the aesthetic transcendence of world literature. In late modern Europe, national literary systems normally show the transition from vernaculars functioning in a multilingual context (usually dominated by a cosmopolitan language) to monolingualism dominated by the ‘national’ literary language, whose standardisation underpins the public sphere of a particular national community. On the other hand, the world literary system is originally multilingual. Foregrounding multidirectional translation, world literature requires cosmopolitanism and polyglottism from its mediators. However, due to the asymmetric distribution of cultural capital, the world literary system tends towards monolingualism; that is, the global hegemony of world languages. Contrary to the cores of literary systems, national and global alike, which lean toward monolingualism, the systemic margins reproduce and even stimulate multilingualism (e.g. minority, regional or mobile literary practices).
Keywords:literary systems, world literature, national literature, multilingualism, monolingualism
Globalisierung ist ein allgemein verbreiteter Euphemismus für die Hegemonie der multinationalen Konzerne in den Händen der transnationalen Plutokratie, den schnellen Transfer von Finanzkapital, für Migration und die ungezügelte Ausbeutung von peripheren Arbeitskräften und Arbeitsmitteln, die neoliberale Unterminierung der Nationalstaaten und die militärische Vernichtung ungehorsamer Peripherien. In der Ideologie ihrer Metropolen erzeugte die sogenannte Globalisierung neben der Theorie und Praxis der Multikulturalität ein weiteres Phänomen: Auch in der Literaturwissenschaft verbreitet sich in letzter Zeit die These, das literarische Schaffen werde zunehmend mehrsprachig, oft auch sprachlich hybrid, sodass es sich in ein transnationales Phänomen im Spannungsfeld zwischen der Vorherrschaft des Englischen im literarischen Welt-System einerseits und der Polyzentralität und Mobilität der Schriftstellerinnen und Schriftsteller andererseits verwandle (vgl. Yildiz 2012: 1–29; Dembeck/Parr 2017: 10–17; Gilmour/Steinitz 2018: 1–15). Doch genau so verhält es sich mit dem Schrifttum in Europa bereits von der archaischen Zeit über die Antike und das Mittelalter bis hin zur frühen Neuzeit, nicht nur in der Literatur des Westens, sondern auch in anderen Zivilisationen (vgl. Forster 1970).
Blickt man zurück in die Vergangenheit des heutigen Slowenien und seiner näheren Umgebung, so stößt man zwangsläufig auf viele Spuren von Mehrsprachigkeit. Neben den Freisinger Denkmälern ( Brižinski spomeniki ), der Sitticher Handschrift ( Stiški rokopis ) und den anderen Dokumenten des Schrifttums der Sprache, die im 19. Jahrhundert unter dem Namen Slowenisch standardisiert wurde, können die lateinischen und deutschen Handschriften für den kirchlichen und weltlichen Gebrauch nicht übersehen werden. Primož TrubarTrubar, Primož, der als Wegbereiter der slowenischen Literatur gilt, schrieb seine Briefe und die Vorworte zu seinen reformatorischen Schriften auf Deutsch, der Kaisersprache des Heiligen Römischen Reiches. Als solche war das Deutsche neben dem Lateinischen und Italienischen auch bei anderen Schreibern in Krain in Verwendung, angefangen von der Gegenreformation und dem Barock, über die Aufklärung bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts, zum Beispiel bei dem Universalgelehrten Johann Weichard ValvasorWeichard Valvasor, Johann, dem slowenischen Komödienschreiber Anton Tomaž LinhartLinhart, Anton Tomaž und sogar dem sog. Nationaldichter France PrešerenPrešeren, France. Diese Kultursprachen ermöglichten den Gelehrten die Arbeit in der europäischen ‚literarischen Republik‘. Davon zeugen die handschriftlichen Nachlässe Valvasors, Johann Ludwig Schönlebens, Siegmund Herbersteins, der Mitglieder der Academia operosorum in Ljubljana (Vidmar 2013), vor allem aber jene des Aufklärers Žiga ZoisZois, Žiga und des „Patriarchen der Slawistik“ Jernej KopitarKopitar, Jernej (Vidmar 2010).
Und heute? Die Dezentralisierung der slowenischen Standardsprache kann bereits seit den umstürzlerischen Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts verfolgt werden, welche im Umfeld der Studentenbewegung den ökonomisch-wirtschaftlichen Status quo zum Bröckeln brachten, und zwar auch mithilfe der theoretischen und literarisch-künstlerischen Dekonstruktion von allem, was bis dahin eine zentrale Position innehatte, von der herrschenden Partei und der bipolaren Weltordnung bis hin zur Literatursprache und Nationalliteratur, zum Kunstwerk und zur kohärenten Struktur des Textes. Der Dichter Tomaž ŠalamunŠalamun, Tomaž gehörte zu den ersten, die in literarische Texte umgangssprachliche, englische, italienische und serbokroatische Elemente einflochten, der Dichter und Dramatiker Milan JesihJesih, Milan sowie der Schriftsteller Marko ŠvabićŠvabić, Marko fügten alldem noch slowenische literarische Archaismen hinzu. Mit ihrem Spiel der Signifikanten, ihrem Ludismus, öffneten sich die Türen der Literatur für die Pluralisierung und Hybridisierung der slowenischen Literatursprache mit Fragmenten aus Dialekten, Soziolekten, benachbarten Sprachen und Weltsprachen sowie der ‚Kreolsprache‘ der Zuwanderer. Dennoch blieb die Autorenfunktion innerhalb des slowenischen literarischen Systems sowohl damals als auch in den folgenden Jahrzehnten noch jenen verwehrt, die für ihre Arbeit und ihre Publikationen nicht die slowenische Standardsprache verwendeten und nicht die slowenische Staatsbürgerschaft besaßen. Sogar Literaturschaffende der slowenischen Volksgruppen in Italien, Österreich oder Ungarn wurden im literarischen Feld des sog. Mutterlandes – ungeachtet der ihnen von Zeit zu Zeit verliehenen Literaturpreise – mehrheitlich eher an den Rand gedrängt. Bis zum kürzlich erfolgten internationalen Durchbruch der Triester literarischen Autorität Boris PahorPahor, Boris traten sie nicht als exponierte Protagonisten auf, welche die slowenische künstlerische Entwicklung und politische Geschichte mitbestimmen. Auch die slowenische Dialektliteratur konnte keine wirklich bemerkbare Strömung erzeugen, sondern wurde als kurzfristige Nische innerhalb des postmodernen Ethno-Angebots angenommen.
Читать дальше