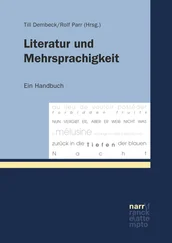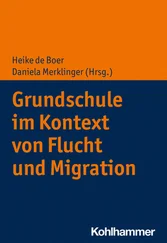Seit der Erlangung der Unabhängigkeit des Staates Slowenien machen sich im literarischen Feld auch Autorinnen und Autoren bemerkbar, die (teilweise) einen Migrationshintergrund haben und zweisprachig sind. Josip OstiOsti, Josip, Lidija DimkovskaDimkovska, Lidija, Goran VojnovićVojnović, Goran und andere haben sich mit Publikationen in slowenischer Sprache in die Medien, Institutionen und Verbände des slowenischen literarischen Systems integriert; als slowenische Autoren setzen sie sich auch international durch. Jene Autorinnen und Autoren mit Migrationshintergrund, die nicht auf Slowenisch schreiben und publizieren, sind jedoch immer noch ghettoisiert. Dies liegt einerseits an der Trägheit des „monolingualen Paradigmas“ (der Begriff stammt von YildizYildiz, Yasemin (2012)), das derartige Phänomene als Emigrations- bzw. Migrationsliteratur bezeichnet, d.h. als dislozierte Einheit aus anderssprachigen literarischen Systemen (vgl. Žitnik Serafin 2008).Žitnik Serafin, Janja1 Ihren Teil zur Exklusion haben in Slowenien auch die Fremdenfeindlichkeit und die Überlegenheitskomplexe gegenüber dem sog. Balkan beigetragen, die als Phänomen des nesting orientalism (Bakić-Hayden 1995) ebenso in anderen aus den Trümmern des Ostblocks und des blockfreien Jugoslawien entstandenen Staaten bekannt sind.
Wenn also bereits ein oberflächlicher Blick offenbart, dass die Literatur in Slowenien nie lediglich einsprachig slowenisch war, wie kann man sich dann erklären, dass wir uns trotz der noch bis vor Kurzem den Diskurs der Political Correctness beherrschenden Idee der Multikulturalität2 so hartnäckig an die Vorstellung klammern, dass sich jede Schriftstellerin und jeder Schriftsteller nur in der sog. Muttersprache authentisch ausdrücken könne, und dass jedem einzelnen Volk nur eine einzige Literatursprache und Literatur gehörten? Warum betrachten wir auch die Weltliteratur als Verbindung nationaler Literaturen in voneinander unterscheidbaren Sprachen, die ebenso räumlich getrennt und abgezählt werden können? Bei der Beantwortung dieser Fragen stütze ich mich auf zwei aktuelle Konzeptionen – auf YildizYildiz, Yasemin’ (2012) Kritik des „monolingualen Paradigmas“ und BeecroftsBeecroft, Alexander (2015) „Ökologie der Weltliteratur“ – und stelle die Problematik in einen breiteren historisch-theoretischen Kontext zwischen BachtinsBachtin, Michail (1979: 154–300) Idee der Heteroglossie und systemischen Zugängen (Even-Zohar 1990).
Michail Bachtin betont die entwicklungsgeschichtliche Bedeutung der Redevielfalt als diskursive Situation im Gegensatz zur einheitlichen Rede und Monologizität, d.h. der Vorherrschaft einer Rede über alle anderen. Die Redevielfalt bringt im Gegensatz zur Monologizität die Dialogizität hervor. Durch die Konfrontation, Verflechtung, Interaktion und Kreuzung unterschiedlicher Sprachen öffnet sich die Gesellschaft, die Durchsetzung unterschiedlicher gesellschaftlicher Interessen und konfliktträchtiger ideologischer Perspektiven wird ermöglicht. Somit nähert sich die (dialogisierte) Bedeutungsstruktur des gesellschaftlichen Diskurses an die unvollendete Komplexität der Wirklichkeit an, weshalb sie im wahrsten Sinne des Wortes modern, gleichzeitig zum Geschehen der Wirklichkeit selbst wird. Auch Itamar Even-ZoharEven-Zohar, Itamar betont in seiner Polysystemtheorie – darin interpretiert er das Kommunikationsschema bedeutungsvoll in Kategorien des Marktes – die evolutionäre Rolle der Heteroglossie, der Heterogenität und der Interferenzen, d.h. der Interaktionen zwischen den unterschiedlichen Sprachen und Systemen. Mit Interferenzen könne nach Even-Zohar die Stagnation in den Systemen, die sich ansonsten an ihr eigenes Repertoire klammern und zu erstarren drohen, überwunden werden. Vor dem Hintergrund von Bachtins und Even-Zohars Auffassungen, welche die Mehrsprachigkeit als Triebfeder der literarischen Entwicklung sowie als Kriterium für Modernität betrachten, stellt sich noch viel dringlicher die Frage, warum gerade die schon seit etwa 200 Jahren vorherrschenden modernen literarischen Systeme (die nationalen literarischen Systeme und das literarische Welt-System) in ihrer Entwicklung von der Mehrsprachigkeit zur Einsprachigkeit strebten.
Sowohl Yasemin YildizYildiz, Yasemin als auch Alexander BeecroftBeecroft, Alexander weisen die feste Formel ‚Eine Sprache – ein Volk – eine Literatur‘ zurück. Selbst eine Sprache, die über eine eindeutige ethnische Denomination und sprachwissenschaftliche Standardisierung verfügt, ist tatsächlich nur eine von mehreren dialektal, funktional und soziolektal varianten Praktiken, welche durch einige phonologische, morphologische, lexikalische und syntaktische Merkmale zu einer Einheit verbunden werden. Die Standardvariante nimmt im sprachlichen Diasystem aufgrund ihrer durch die Verschriftlichung und die Medien unterstützten Normierung, Stabilität und allgemeinen Verbreitung, noch mehr aber aufgrund ihrer Repräsentativität bei der Gestaltung und Verbreitung von für den Bestand des Staates, der Religion, der Wissenschaft, Kunst und Öffentlichkeit bedeutenden Inhalten eine zentrale Stellung ein. Die innere Schichtung und Varianz, in der die einzelne Sprache lebt, wird durch die Durchlässigkeit zwischen ihren Dialekten und den Dialekten der Nachbarsprachen noch zusätzlich verkompliziert. Die Abgrenzungen zwischen ihnen sind nicht linguistischer Art, sondern das historische Produkt von Ideologien sowie geopolitischen und religiösen Faktoren. Nicht zuletzt haben auch langfristigere Kontakte zwischen den Sprachen unterschiedlicher Völker, zu welchen es aufgrund von Migrationen, Eroberungen oder der Herrschaft des einen Volkes über andere kam, in jede Sprache auch fremdsprachige Beimengungen gebracht; demzufolge ist keine Sprache rein und autonom.
Ähnlich wie mit den Sprachen verhält es sich mit den Literaturen der Welt. Obwohl der Begriff Literatur zweifellos moderner und europäischer Herkunft ist, möchte uns BeecroftBeecroft, Alexander (2015: 8–14) davon überzeugen, dass eine nicht-eurozentrische Erörterung dieses Phänomens nichtsdestotrotz möglich sei, existierten doch auch in anderen Zivilisationen Konzeptionen, welche – ähnlich der europäischen Ästhetik ab dem 18. Jahrhundert – einen Diskurs hervorbringen, der anspruchsvoller gestaltet und schwerer begreifbar für ein gebildetes Publikum bestimmt und imaginativ sei. Literatur ist also etwas Universelles. Und was ist mit den Literaturen, könnte man mit Beecroft (2015: 14–17) fragen. Gehört jede Literatur einer räumlich und ethnisch festgelegten Gemeinschaft?
Johann Wolfgang von GoetheGoethe, Johann Wolfgang von, der nach August Ludwig von SchlözerSchlözer, August Ludwig von, Historiker der Aufklärung und Begründer des Begriffs Weltliteratur , ebendiesen in den Zwanzigerjahren des 19. Jahrhunderts unter den europäischen Weltbürgern verbreitete, stellte sich im Aufsatz Epochen geselliger Bildung im Jahr 1831 die weltweite Entwicklung des literarischen Schaffens als Abfolge von der „idyllischen“ Epoche der engen, sprachlich selbstgenügsamen Gemeinschaften bis zur kommenden „universellen“ Epoche der weltweiten kulturellen Interaktion vor (Goethe 1999: 554–555). Nach ähnlichen Überlegungen über verschiedenartige soziale Gemeinschaften, innerhalb welcher in unterschiedlichen Zeitabschnitten und Zivilisationen die Wortkunst lebte, integrierten im 20. Jahrhundert die vergleichenden Literaturwissenschaftler Dionýz ĎurišinĎurišin, Dionýz (1984: 273–308; 1992: 109–138) und Irina NeupokoevaNeupokoeva, Irina (2012) das Konzept der Nationalliteraturen in ein System von Begriffen für sozialgeschichtliche Einheiten der literarischen Kommunikation; solche Begriffe sind zum Beispiel der Stamm, der antike und mittelalterliche Stadtstaat, die mittelalterliche Ethnie, die moderne Minderheit, die regionale Zone oder die interliterarische Gemeinschaft, welche durch Sprache, Religion, geographische Lage oder einen staatlich-politischen Rahmen verbunden ist. In der heutigen Zeit, die erstaunlicherweise auch in der Geisteswissenschaft zwischen dem transnationalen Trieb der (neo)liberalen Globalisierung und einem neu erweckten Nationalismus und Rassismus des rechtspopulistischen Widerstands gegen die Globalisierung pendelt, versucht mit ähnlichen Kategorien wie Neupokoeva und Ďurišin auch Alexander BeecroftBeecroft, Alexander die tief verwurzelte Annahme in Frage zu stellen, dass die Nationalliteratur das Elementarteilchen der Weltliteratur sei. In der Geschichte des Nordens und Südens, des Ostens und Westens der Welt schält er nämlich neben dem nationalen noch viele andere „Ökosysteme“ des Literaturkreislaufs heraus, welche die Weltliteratur geprägt haben. Er nennt sie die epichorische, panchorische, kosmopolitische, vernakuläre, nationale und globale Literatur (Beecroft 2015).
Читать дальше