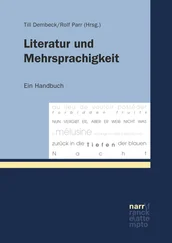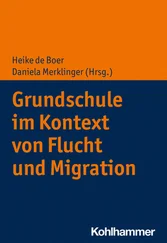Der Zögling Tjaž (1981) von Florjan LipušLipuš, Florjan vermochte zunächst nur wenig an der Randposition nichtdeutschsprachiger Literatur zu verändern. Noch 1986 stellte der Lyriker Jani OswaldOswald, Jani ironisch fest, dass durch das Gerede um eine Literatur, die im Original fast niemand kenne und die nur zum Teil über gute Übersetzungen zugänglich sei, die Rolle der Kärntner slowenischen Autor_innen als „Exoten“ auf dem Schauplatz der österreichischen Literatur lediglich einzementiert werde (Oswald 1986: 16). Erst mit dem Ende des realen Sozialismus und der politischen Neuordnung Europas begann sich das österreichische literarische Feld für die Literatur der sogenannten Volksgruppen oder autochthonen Sprachminderheiten, vor allem der Kärntner Slowen_innen, später auch für die Literatur von zugewanderten Autor_innen (vgl. Sievers 2017: 30–35) zu öffnen. Ein erstes Zeichen der Sichtbarmachung nichtdeutschsprachiger Autor_innen war Gerald Nitsches Anthologie
Österreichische Lyrik … und kein Wort Deutsch (1990) mit Texten von knapp 40 Migrant_innen und Minderheitenangehörigen,1 der noch weitere Anthologien dieser Art folgten, allerdings blieb das wissenschaftliche Interesse an Migrant_innenliteratur wie auch am Thema Migration bis in die frühen 2000er Jahre verhalten.2 Zur bereits früher einsetzenden und zunächst breiteren Wahrnehmung der Literatur der Kärntner Slowen_innen trugen neben der regen literarischen Produktion auch die slowenischen bzw. zweisprachigen Kärntner Verlage, die aufkommende Übersetzungstätigkeit und nicht zuletzt die im Bereich literarischer Mehrsprachigkeit anzusiedelnden komparatistischen und literaturpädagogischen Forschungen an der Universität Klagenfurt wesentlich bei.3 Diese sind auch deshalb von Bedeutung, weil dadurch Texte Kärntner slowenischer Autor_innen Aufnahme in den sich herausbildenden literarischen Mehrsprachigkeitsdiskurs fanden (vgl. Strutz/Zima 1996).Oswald, JaniHaderlap, Maja4 Vor allem die Literaturpädagogik war bestrebt, die Literaturen von Minderheiten und Migrant_innen gleichwertig zu vermitteln (vgl. Wintersteiner 2006: 115, 146–148; Mitterer/Wintersteiner 2009) und räumte ihnen aufgrund ihrer interkulturellen und interlingualen Eigenschaften auch einen Platz innerhalb des Konzepts kulturvermittelnder Weltliteratur ein (Wintersteiner 2006: 240–242, 269–272). Folgerichtig stellte die neuere Literaturgeschichtsschreibung schließlich fest, dass „Mehrsprachigkeit und Multikulturalität am Beginn des 21. Jahrhunderts wieder zu einem wichtigen Element der österreichischen Literatur“ geworden sind (Kriegleder 2011: 571), und nahm daher auch Literatur migrierter oder einer ethnischen Minderheit zuordenbarer Autor_innen in die Gesamtdarstellung österreichischer Literatur auf (vgl. Kriegleder 2011; Zeyringer/Gollner 2012). Nicht alle Institutionen im österreichischen literarischen Feld halten mit dieser Entwicklung Schritt, weshalb sich immer wieder die Notwendigkeit ergibt, Anpassungen vorzunehmen, beispielsweise um auch nicht Deutsch schreibende Autor_innen mit wichtigen nationalen Auszeichnungen und Preisen würdigen zu können.Lipuš, Florjan5
In der Grundtendenz ähnlich und doch wesentlich verschieden sind die Verhältnisse in Bezug auf nichtslowenische Literatur und literarische Mehrsprachigkeit in Slowenien. Die im 19. Jahrhundert postulierte Existenz einer slowenischen Sprach- und Kulturnation, die sich unter anderem gerade durch die Berufung auf die Literatur legitimierte und emanzipierte, fand gewissermaßen ihre Erfüllung in der 1991 ausgerufenen staatlichen Souveränität Sloweniens.6 Die Literatur und ihre Repräsentanten und Institutionen verloren danach rasch an ‚nationaler‘ Bedeutung, jedoch etablierte sich das Slowenische als die gesellschaftlich und literarisch dominante Sprache. Die autochthonen ethnischen Minderheiten erhielten umfassende Rechte, wurden aber genauso wie die zahlenmäßig zum Teil weitaus stärkeren, als Minderheit jedoch nicht anerkannten Ethnien aus den anderen ehemaligen Teilrepubliken Jugoslawiens im neu entstandenen slowenischen literarischen Feld marginalisiert.7 Folglich gab es kaum Anlass, unter ‚slowenischer Literatur‘ etwas anderes zu verstehen als in slowenischer Sprache geschriebene Literatur, und zwar unabhängig davon, wo sie entsteht und veröffentlicht wird. Nicht zuletzt wird dieses Bild durch die slowenische Literaturgeschichte verfestigt, die seit ihren Anfängen auf in slowenischer Sprache geschriebene Literatur abgestellt ist.8 Eine neue, konzeptuell die Gesamtheit der Sprachen und Literaturen Sloweniens berücksichtigende Literaturgeschichte liegt zwar nicht vor, jedoch hat Miran HladnikHladnik, Miran bereits nachdrücklich darauf hingewiesen, dass der Begriff ‚slowenische Literatur‘ wesentlich breiter gefasst werden muss, als dies in den bisher erschienenen Literaturgeschichten der Fall ist. Seiner Ansicht nach ist Slowenisch als Sprache des Originals für die Einordnung eines Textes unter diesen Begriff kein Schlüsselkriterium mehr, vielmehr seien auch Übersetzungen ins oder aus dem Slowenischen und anderssprachige Literatur slowenischer oder anderer Autor_innen, die in Slowenien gelesen werden, ebenfalls zu berücksichtigen (Hladnik 2013: 323). Um überhaupt eine „emanzipierte Diskussion“ über die verschiedenen Literaturformen im slowenischen Zusammenhang zu ermöglichen, schlug er des Weiteren vor, statt des üblichen Terminus ‚slowenische Literatur‘ den Begriff „literatura na Slovenskem“ (‚Literatur im slowenischen Raum‘) zu verwenden (Hladnik 2016: 49).9 Die Bestrebungen, die interkulturelle Verfasstheit der slowenischen Gesellschaft und Literatur stärker ins Bewusstsein zu heben, nehmen ihren Ausgang Mitte der 2000er Jahre, als die Anglistin und Literaturhistorikerin Meta GrosmanGrosman, Meta 2004 einen vielbeachteten Band zum Thema Literatur in der interkulturellen Kommunikation veröffentlichte. Schon im darauffolgenden Jahr war das traditionelle Sommerseminar an der Universität Ljubljana der Multikulturalität in der slowenischen Sprache, Literatur und Kultur gewidmet (vgl. Stabej 2005), und in den Jahren 2004 bis 2007 beschäftigten sich Janja Žitnik SerafinŽitnik Serafin, Janja, Lidija DimkovskaDimkovska, Lidija und Maruša Mugerli LavrenčičMugerli Lavrenčič, Maruša in einem Forschungsprojekt mit dem literarischen und kulturellen Bild der Einwanderer in Slowenien, aus dem unter anderem eine bis heute zentrale Monographie zur Lage der Migrantenliteratur und -kultur im slowenischen Raum hervorging (vgl. Žitnik Serafin 2008). Ebenfalls 2008, im Europäischen Jahr des interkulturellen Dialogs unter slowenischer EU-Ratspräsidentschaft, wurde anlässlich des Slowenischen Slawistenkongresses in Klagenfurt, der zugleich dem 500. Geburtstag des Reformators und Begründers der slowenischen Schriftsprache Primož TrubarTrubar, Primož gewidmet war, der Versuch unternommen, die interkulturelle Slowenistik in Fachvorträgen (vgl. Košuta 2008) und durch einen Runden Tisch zum Thema10 stärker zu profilieren. Mittlerweile haben die Themen Interkulturalität und Mehrsprachigkeit Eingang in zahlreiche gesellschafts- und geisteswissenschaftliche Forschungsbereiche gefunden, zumal es in Slowenien eine lange Tradition in der Ethnizitäts- und Minderheitenforschung gibt, wohingegen sie in der slowenistischen Literaturwissenschaft, aber auch im slowenischen literarischen Feld insgesamt noch immer eher ein Randthema sind. Neben Miran HladnikHladnik, Miran, der in seinen Forschungen in erster Linie die Literaturbeziehungen in der älteren slowenischen Literatur in den Blick nimmt, und Silvija BorovnikBorovnik, Silvija, die sich seit den 1990er Jahren mit interkulturellen Aspekten und Mehrfachzugehörigkeiten in der zeitgenössischen slowenischen Literatur auseinandersetzt (vgl. Borovnik 2017), widmen sich zwar auch zahlreiche andere Forscher_innen mitunter diesem Themenkomplex, trotzdem hat sich weder in der slowenischen noch in der slawistischen noch in der vergleichenden Literaturwissenschaft ein Forschungszweig herausgebildet, der sich speziell mit literarischer Mehrsprachigkeit beschäftigen würde. Sogar der Begriff ‚literarische Mehrsprachigkeit‘, dem im Slowenischen die Bezeichnungen ‚literarna večjezičnost‘ oder ‚literarno večjezičje‘ entsprechen, scheint, gemessen an der Häufigkeit seiner Verwendung, fast noch ein Neologismus zu sein.
Читать дальше