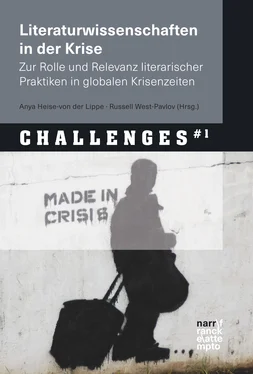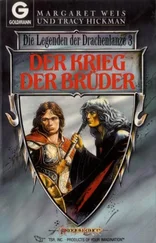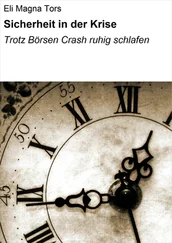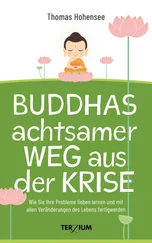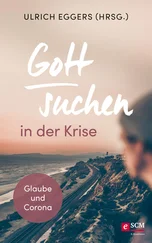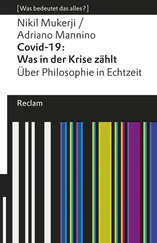I Bestandsaufnahmen
1 »Nach der Krise ist vor der Krise«
Vom Überleben in, mit und durch die Krise
Dorothee Kimmich
Eine Krise der Geisteswissenschaften an den Universitäten aber auch außerhalb von ihnen zu konstatieren, ist notorisch und verheißt im Prinzip nichts Neues. Seit Jahren und ganz abgelöst vom wie auch immer beklagenswert sich darbietenden Realzustand der humanities stößt solches Lamento auf gleichsam rhetorische, durchwegs habituelle Zustimmung. […] Es scheint, als leiden die Geisteswissenschaften und die mit ihnen epistemisch verwandten heuristisch orientierten Gesellschaftswissenschaften unter einem kaum korrigierbaren und sich praktisch auswirkenden beständigen Legitimationsdefizit. (Diner 2003: 70)
Der Historiker, Publizist und Wissenschaftsmanager Dan Diner hat diese Sätze vor mehr als zehn Jahren formuliert – und es ist keineswegs der erste Kommentar zur Lage der Humanities. Schon vor ihrer eigentlichen Existenz gab es Kritik: Leonardo Bruni Aretino, Humanist und Staatskanzler im Florenz des frühen 15. Jahrhunderts, bemerkt verächtlich gegenüber Philosophie-Professoren, dass er ihnen lieber beim »Schnarchen als beim Reden zuhören« würde (Bruni Aretino 1984: 93). In eine ähnliche Richtung zielt das immer wieder gern bediente Bild des »faulen Professors« (Enders und Schimank 2001: 159–178), der die Autonomie von Forschung und Lehre dazu nutzt, sich ein schönes und vor allem geruhsames Leben zu machen. Um die ganze Sache rund zu machen, gehört dazu noch eine Studentenbeschimpfung, wie sie unlängst wieder im Spiegel nachzulesen war: Germanistikstudenten – noch mehr offenbar Studentinnen – haben keine Ahnung vom Lesen, noch weniger von Literatur und schon gar nicht von Goethe, den sie nur noch als »so nen Toten« kennen (Doerry 2017: 105–109).
Im Spiegel geht es nicht um eine Abrechnung mit den Humanities im Allgemeinen, sondern mit dem größten Fach innerhalb der Literaturwissenschaften, mit der Germanistik: Sie sei riesig, aber marginal. Sie bringe weder gute Lehrende noch gute Kritiker*innen hervor, anders als dies (früher? zu Zeiten von Walter Jens?) einmal war. Berufsfelder wie das Feuilleton und der viel beschworene Lektoratsjob verschwinden, weil Zeitungen und Verlage keine Literaturwissenschaftler*innen brauchen. Diese dagegen landen, wie uns Doerry Houllebecq zitierend belehrt, bei Hermès im Verkauf. Im Vergleich zu anderen Studienfächern scheinen die Literaturwissenschaften und dabei insbesondere die Germanistik – für die man nicht einmal Englisch können muss, geschweige denn so etwas Kompliziertes wie Rechnen – schlechte Studierende anzuziehen und aus motivierten Lehrenden frustrierte akademische Verwaltungsangestellte zu machen.
Diese Kritikpunkte lassen sich noch ergänzen durch die Kritik an der Institution Universität insgesamt, die – je nach nationaler Bildungspolitik – entweder vollkommen unterfinanziert ist, wie in Italien und Deutschland, oder große interne Qualitätsunterschiede aufweist wie etwa in Frankreich und den USA. Drittmittelpolitik in unterschiedlicher Form, der dauernde Druck, Geld einzuwerben, die deutsche Exzellenzinitiative mit ihren Tausenden von Anträgen, die zigtausende von Arbeitsstunden verschlingen, werden ebenso getadelt wie neue Besoldungsrichtlinien für Wissenschaftler*innen, die offenbar die Vertreter der Naturwissenschaften bevorzugen. Die nicht abreißende Debatte um die Relevanz philologischer Kompetenzen gehört ebenso zum Kanon der Einwände wie die Kritik an den Schulen und dem Niveau, mit dem sie Schüler*innen an die Universität entlassen (Lehrlinge bzw. Azubis allerdings können auch nichts mehr!).
Mit dem Verschwinden des Bildungsbürgertums und seiner Wertvorstellungen, seinem Bildungskanon und seinen Ausbildungspraktiken verschwanden auch die Sicherheit und Selbstverständlichkeit der zu vermittelnden Inhalte in Literatur, Kunst und Musik (vgl. Erhart 2003a: 108–125). Die damit verbundene Warnung vor dem Untergang der Bildung im Internetzeitalter ist zum Gemeinplatz geworden: Das »Ende der Gutenberg-Galaxis« (Bolz 1995) war erst nur ein schönes Bonmot – und heute haben wir dieses Ende so weit hinter uns gelassen, dass es selbst schon Geschichte geworden ist. In all dem ist nichts Positives zu erkennen; außer vielleicht der Tatsache, dass Bildung offensichtlich zu allen Zeiten wenn nicht alle, so doch viele anzugehen scheint, und dass man Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen, ja, dass man bestimmten Fächern und Disziplinen offenbar viel zutraut – oder eben auch viel zumutet.
Die Kritikpunkte sind fast alle berechtigt – und genau dies mag einen skeptisch stimmen. Sie zielen auf die Universitäten ganz allgemein, besonders aber auf die Literatur- und Kulturwissenschaften und im Speziellen häufig auf die Germanistik. Selten wird so viel Häme über die juristischen Fakultäten, die theologischen Seminare, die Archäologie oder auch die Geschichte ausgeschüttet wie über die Literaturwissenschaften. Man fragt sich manchmal, warum. So viel Kritik, und aus so unterschiedlichen Perspektiven? So viele implizite und explizite Forderungen und Erwartungen, die, würde man versuchen, sie alle zu erfüllen, sicherlich kein konsistentes Bild ergeben würden. Vielleicht muss man sich also zunächst einmal fragen, was eigentlich solche Empörung auslöst. Wie sieht der Katalog der Wünsche aus? Woher kommt die krasse Kritik?
Geisteswissenschaften – oder, um den irreführenden Begriff des »Geistes« zu vermeiden, besser: Humanities – sollen historisches und zeitgenössisches Wissen bewahren, es pflegen, sie sollen es erhalten, zugänglich und brauchbar machen oder sogar oft die Zugänglichkeit erhalten, indem sie etwa die Kenntnis fast vergessener Sprachen und Schriften, Zeichensysteme und Bilder konservieren und ihre Funktionen trainieren. Die einen loben dabei, dass dies ohne Ansehen von direkter Verwertbarkeit, mit langem Atem und ohne tägliche Überprüfung von aktueller Relevanz geschehen soll und kann. Tagesaktuelle Verwertbarkeit soll und darf dann gerade kein Kriterium sein. Andere reden genau hier vom Elfenbeinturm.
Die Kritiker des Elfenbeinturms nämlich verlangen, dass zeitgenössische Debatten aufgegriffen, überalterte Themen und Thesen verworfen und dezidiert verabschiedet werden. Und nicht nur dies: Zu aktuellen Themen soll es auch noch kompetente und ethisch vertretbare Kommentare, Urteile, politisch und sozial relevante, wirksame Beiträge geben. Universitäten sollen Forschung – nicht nur in den Humanities – garantieren, die nicht von Politik und Lobbyismus beeinflusst ist (dies ist – leider zu selten betont – im Übrigen auch für die Lehre relevant!). Sie müssen mit ihren Ressourcen ökonomisch umgehen und die Ausgabenverteilung an gesellschaftlichen Bedürfnissen ausrichten. Sie sollen einerseits auf Distanz gehen zu den gesellschaftlichen Akteur*innen und Interessent*innen, andererseits nicht im Abseits stehen: Keine leichte Übung!
Universitäten sind – wie fast alle Institutionen – träge, und genau dies ist auch ein nicht zu unterschätzender Vorteil von Institutionen. Anders als wirtschaftlich arbeitende Unternehmen, die auf ökonomische Veränderungen möglichst schnell und flexibel reagieren sollen und müssen, sollten das weder Bildungseinrichtungen noch Gerichte tun:
Die notwendige Autonomie, eine gewisse Freiheit von Marktimperativen und die Distanz zu unternehmerischer Kultur können sich die Geisteswissenschaften nur dann verschaffen, wenn sie bereit sind für diese (notwendige) Sonderstellung auch bestimmte Reformen nicht nur in Kauf, sondern selbst in Angriff zu nehmen. Gelingt dies nicht, leiden darunter nicht nur die Geisteswissenschaften selbst, sondern das gesamte System Universität. (Kimmich und Thumfart 2003: 30)
Die Anpassung von Universitäten an Vorbilder aus Wirtschaft und Industrie ist nicht in jeder Hinsicht unsinnig, eine Vorbildfunktion ökonomischer Strukturen für die Universität kann es aber nicht geben. Moden und Konjunkturen bestimmen nicht den Pulsschlag von Universitäten. Das mag man bedauern. Tatsächlich sammelt sich daher eine Menge Muff – auch unter den z. T. wieder eingeführten Talaren – in Bürokratien, Studienplänen, Prüfungsordnungen, Leselisten und Forschungsprojekten. Autonomie von wirtschaftlichem Effektivitätsdruck und gesellschaftlicher Relevanz führt nicht per se zu wissenschaftlichen Hochleistungen. Aber umgekehrt gilt dies eben genauso: Ständiger Effektivitätsdruck und Relevanzforderungen garantieren eben leider auch keine gute Forschung!
Читать дальше