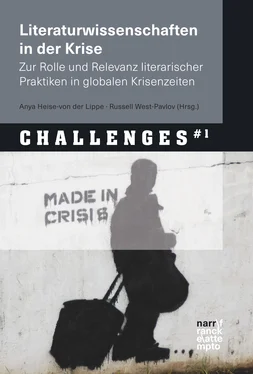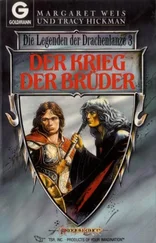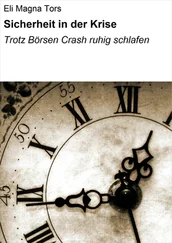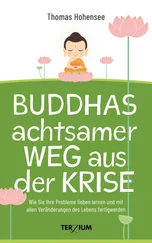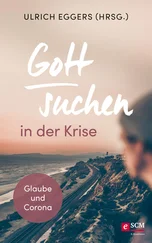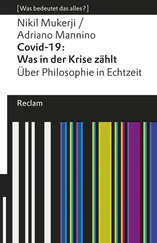1 ...6 7 8 10 11 12 ...20 Im Grunde können wir festhalten, dass gerade die Literaturwissenschaften diejenigen Stimmen hervorbringen, die im richtigen Moment darauf hinweisen, dass sie sich – in bestimmter Hinsicht – überlebt haben. (Das gilt übrigens auch für den Verfasser des kritischen Spiegel -Artikels, der – natürlich – u.a. Germanistik studiert hat.) Aber was – bitteschön – will man denn sonst? Das genau ist doch die viel beschworene kritische Haltung, die man sich von Akademiker*innen wünscht.
Oft geht es um sehr komplexe und ernsthafte Auseinandersetzungen mit hoch komplizierten Entwicklungen. Wir werden z.B. zweifellos in den kommenden Jahren und Jahrzehnten vollkommen neue Konzepte von Weltgeschichte und Weltliteratur brauchen. Leider wird uns Goethe – auch wenn er den Begriff populär gemacht hat – nicht viel weiterhelfen können. Allein die Daten- und Textmengen werden sich nur mit Hilfe von Digitalisierungsmethoden verwalten lassen, denn Weltliteratur ist eben nicht die Kombination von Schiller, Montaigne, Shakespeare und Cervantes, sondern umfasst Mythen und Lieder, Romane und Geschichten, Anekdoten und Märchen der ganzen Welt und aller Sprachen. Im Moment kann sich – trotz gegenteiliger Behauptungen – niemand vorstellen, wie eine Literaturwissenschaft aussehen soll, die mit solchen Mengen umgehen kann, und in der Zwischenzeit behelfen wir uns mit meist eurozentrischen Hilfskonstruktionen, die methodisch unseriös sind, da sie ungerechtfertigterweise – oft leider nur implizit – Repräsentativität postulieren. Eine ganze Reihe anderer Entwicklungen – etwa im Bereich der Digital Humanities oder der Neuroästhetik – könnte hier ebenfalls und mit gleichem Recht genannt werden.
Es mag für manche ›irrelevant‹ klingen, sich mit der Frage nach Weltliteratur zu beschäftigen, angesichts von Dieselskandal und Flüchtlingskatastrophen. Tatsächlich werden die Auswirkungen eines Umbaus literaturwissenschaftlicher Fächer und Konzepte erst in vielen Jahren wirklich zu spüren sein. Es handelt sich dabei um Entwürfe für einen Umgang von Ethnien, Nationen und Kulturen in postkolonialen Kontexten, für die es sich lohnt, lange Zeit zu investieren. Dieser Umbau von Disziplinen und Fächern wird nicht nur universitäre Forschung, sondern eben auch Lehrpläne und Kulturprogramme, die Politik und den alltäglichen Umgang miteinander prägen. Dies allerdings nur, wenn man diejenigen, die in diesen Bereichen arbeiten, auch anerkennt; und dies bedeutet: sie für ihre Arbeit entlohnt und ihnen zuhört. Hier mit Umsicht vorzugehen, wird gut sein. Man wird dabei auf alte Wissensbestände zurückzugreifen haben: Und da werden die Kritischen und die Kurator*innen im Bereich der Humanities kooperieren müssen.
Wohlfeil ist es auch, über ›Gender-Studies‹ zu spotten (vgl. Handelsblatt 2013; Emma 2017): Wer aber hätte es noch in den 80er Jahren für möglich gehalten, dass sich in unseren Gesellschaften homosexuelle und transsexuelle Lebensentwürfe innerhalb von drei Jahrzehnten durchsetzen lassen? Begriffe, Konzepte, ethische Forderungen und normative Umbesetzungen wurden in der Politik konkret, aber sie wurden erst einmal in der Theorie vorgedacht und debattiert. Wo hätten sie denn entwickelt werden sollen, wenn nicht an den Universitäten? Heute, wo das alles selbstverständlicher geworden ist, lässt sich gut spotten. Die ersten Seminare zu Gender Studies anzubieten, war eine Leistung – und sie hat sich gelohnt. Allerdings lässt sie sich eben schlecht messen. Dazu muss man schon etwas genauer hinsehen, etwas mehr Ahnung von Kulturgeschichte haben und einen etwas längeren Atem mitbringen … Alles so genannte ›soft skills‹, die man sich etwa in einem historischen oder kulturwissenschaftlichen Studium aneignen kann.
Kaum ein Artikel zur Lage der Literatur- und Kulturwissenschaften kommt ohne einen Verweis auf die besondere Bedeutung von ›Kritik‹ oder ohne das Lob des kritischen Geistes aus, den man in diesen Fächern erlernen oder erwerben kann. Felski weist darauf hin, dass viele »critique« als eine Art »guiding ethos« der Humanities verstehen (Felski 2016: 216). Das ist sicherlich nicht falsch, bleibt aber oft unkonkret. Was soll man sich genau unter dieser Kritik oder dem kritischen Geist vorstellen? Ist Kritik nicht oft auch zu wenig (vgl. Felski 2017: 344–51)? Statt nur auf die kritische Komponente der Humanities möchte ich daher hier auf einen anderen Aspekt hinweisen, der sicherlich Teil von kritischen Reflexionen ist, aber nicht darin aufgeht: Die Fähigkeit, zu urteilen.
Urteilen ist eine komplexe Praxis und beginnt bereits mit der Auswahl von Adjektiven, wenn man einen Sachverhalt beschreibt, mit dem Einsatz bestimmter Metaphern, wenn man eine Handlung, einen Gegenstand oder auch eine Person nachzeichnet. Jeder kennt das aus Bewerbungsgesprächen: Die erfolgreiche Frau ist ›ehrgeizig‹, der Mann ›durchsetzungsfähig‹. Der ›kleine Unterschied‹ kostet vielleicht den Job. Die Art und Weise, wie Eigenschaften attribuiert werden, macht Handlungen und Menschen vergleichbar mit anderen Menschen, mit anderen Erfahrungen, stellt sie jeweils in den einen oder den anderen Kontext. Diesen Verfahren liegen meist implizite Entscheidungen und – meist wenig bewusste – Urteile zugrunde. Sie basieren auf Vergleichen und Ähnlichkeitsbeziehungen und sind in den allermeisten Fällen weder messbar noch falsifizierbar oder beweisbar. Sie sind nicht transparent und schon gar nicht objektiv. Wir befinden uns auf einem Terrain, das vage, diffus, komplex und unübersichtlich ist.
Es ist das Feld, in dem Literatur- und Kulturwissenschaftler*innen zuhause sind; gewissermaßen der Urwald, in dem sie sich auskennen, hier können sie ihre Diagnosen stellen, ihre Expertise formulieren und ihre Techniken der Erkenntnis zur Anwendung bringen. Es ist das Feld der symbolischen Kommunikation, die vom Einkaufszettel bis zu Zettel’s Traum reicht. Die größte Menge an Weltwissen findet sich ja gerade nicht dort, wo Exaktheit und Klarheit herrschen, sondern dort, wo im Ambivalenten formuliert werden muss, wo Aussagen Urteile implizieren und damit Handlungen generieren (können). Man könnte so etwas die Ambiguitätstoleranz der Literaturwissenschaften nennen. Ich würde gerne weitergehen und es die Diffusitätskompetenz nennen, also die Fähigkeit, gerade nicht ›schwarz und weiß‹ zu denken, ›hüh oder hott‹ zu sagen, ›entweder oder‹ zu handeln, sondern ›sowohl als auch‹, und im Graubereich zu urteilen, abzuwägen, auszutarieren, fein abzustimmen, auszubalancieren.
Es handelt sich um die Fähigkeit, begründet zu urteilen. Die meisten – politischen, privaten oder beruflichen – Entscheidungen beruhen nicht auf objektivem Zahlenmaterial, sondern auf einem komplexen Ineinander von Erfahrung und Information. Differenziert und begründet urteilen zu können, ist eine Kunst. Oder anders: Es ist eher eine Praxis als eine Theorie, die sich durch Einübung und Lektüre erlernen lässt. Diese Praxis, die durchaus auch zur ›Kritik‹ gehört, ist eine der größten Stärken der Literaturwissenschaften. Sie zu so genannten ›exakten‹ Wissenschaften machen zu wollen – was immer das letztlich sein soll –, führt dagegen unweigerlich zu Banalitäten, redundanten Aussagen und zur Selbstabschaffung.
Literatur- und Kulturwissenschaften machen das kompliziert, was auf den ersten Blick einfach erscheint. Sie brechen das Normale auf, ändern den Kontext und machen sichtbar, was sich im ›Normalen‹ verbirgt: Manchmal eine Fratze, manchmal ein Schatz. Dem Normalen die Stirn zu bieten, heißt aber nicht notwendig immer, auf den Putz zu hauen und mit dem großen Thesenbesen einen Kehraus zu veranstalten. Manchmal sitzt man eben monate-, ja jahrelang am Schreibtisch, im Archiv oder in der Bibliothek, bis man die Stellschraube gefunden hat, die am Ende eine wacklig gewordene Konstruktion zum Einsturz bringt. Manchmal findet man diese Schraube nie.
Читать дальше