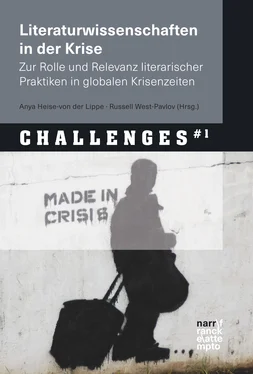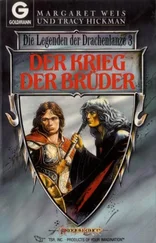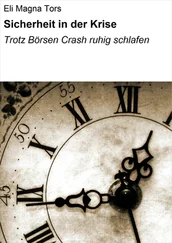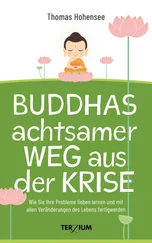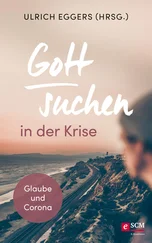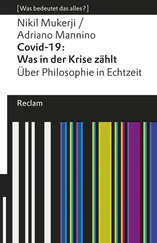Die reichen demokratischen Länder, die großen Wirtschaftsmächte, die G7 oder G8, die ehemaligen Kolonialherren und ehemaligen Industriestandorte sind in ein reaktionäres Zeitalter abgerutscht. Ihr schönstes Gefühl ist Nostalgie. Sie wollen keine Zukunft. Zukunft ist Veränderung, und Veränderung ist Verschlechterung, bedeutet millionenfache Migration, Klimawandel, kollabierende Sozialsysteme, explodierende Kosten, Bomben in Nachtklubs, Umweltgifte, ausbleichende Korallenriffe, massenhaftes Artensterben, versagende Antibiotika, Überbevölkerung, Islamisierung, Bürgerkrieg. Zukunft sollte vermieden werden. Die Menschen in der reichen Welt wollen nur, dass die Gegenwart nie endet. (Blom 2017: 16)
Gerade deshalb kann der krisengeplagte globale Süden, in dem die Menschen auf kreative Eigenlösungen angewiesen sind, einen besonderen Modellcharakter für die Lösung dieser Probleme einnehmen, wie auch Mbembe argumentiert. Jenseits euro-amerikanischer Theoriemodelle und altbekannter Narrative könnten kreative Fragestellungen eine Schlüsselrolle in der Neubewertung der Geisteswissenschaften (und Universitäten insgesamt) jenseits ihrer neoliberal-kapitalistischen Nützlichkeit einnehmen. Dies kann und muss im Anthropozän auch eine Neubewertung der Rolle des Menschen (im Englischen durch das »Human« im Begriff »Humanities« repräsentiert) und seiner Auswirkungen auf diesen Planeten beinhalten. Denn nur wenn Geistes- und Naturwissenschaften zusammenarbeiten und neue Fragestellungen und Problemlösestrategien entwickeln, werden wir der Klimakrise überhaupt etwas entgegenzuhalten haben.
Die siebzehn Kapitel des vorliegenden Bandes setzen sich in diesem Sinne kritisch mit der Rolle der Geisteswissenschaften in Krisenzeiten auseinander. In vier Teilen bieten sie Bestandsaufnahmen, Lektüren, Anwendungenund Interventionen.
Ausgehend von Rita Felskis Überlegungen zu den Aufgaben der Geisteswissenschaften – einerseits konservativ-konservatorisches »curating« bzw. »conveying«, andererseits tendenziell innovatives »criticizing« bzw. »composing« – konstatiert Dorothee Kimmich in einer ersten Bestandsaufnahmezwei Tendenzen in der Literaturwissenschaft. Die konservativ-konservatorische Richtung der Germanistik wird zwangsläufig in kommenden Jahrzehnten schrumpfen, so Kimmich. Dagegen wird (und sollte) das innovative Potential des Faches einen Zuwachs erleben. In diesem Sinne entwirft Kimmich ein Programm für solche Fächer bzw. Studiengebiete, die auf die Arbeit des Urteilens und die Erläuterung des Urteils fokussiert sind. In dieser Grauzone des impliziten Wissens, der Ambiguität, der Diffusitätskompetenz – also in Bereichen des Denkens/Handelns, die für unsere heutige Gesellschaft in Zeiten multipler Krisen höchst relevant sind – liegt der eigentliche Kernkompetenzbereich der Geisteswissenschaften. Das Urteilen zu untersuchen ist wichtig, da, so Kimmich, »Literatur- und Kulturwissenschaften gerade das kompliziert machen, was auf den ersten Blick einfach erscheint. Sie brechen das Normale auf, ändern den Kontext und machen sichtbar, was sich im ›Normalen‹ verbirgt«.
John K. Noyes etabliert im zweiten Kapitel ein konzeptuelles Dreieck aus den Eckpfeilern Philosophie, Naturwissenschaften bzw. Technologie und Literatur(wissenschaft). Da wo sich die Philosophie im Zuge ihrer zunehmend sichtbar werdenden Irrelevanz für die Welt der Technologie gänzlich von der Realität abgewandt hat, und wo die naturwissenschaftliche Fetischisierung des Fortschritts als ihre eigene Bankrotterklärung fungiert, kommt der Literatur(wissenschaft) eine wichtige Rolle zu: und zwar die des Möglichmachens einer Rückkehr zu einer scheinbar von der Technologie überholten Vergangenheit, so dass die Literatur(wissenschaft) als ein Locus der Infragestellung des Fortschrittsglaubens hervorzutreten vermag. Literatur(wissenschaft) übernimmt so eine Wächterrolle für das Unbewusste des naturwissenschaftlich modellierten Menschen. Viele Fragen der Technologie, z.B. die ihrer Gewinne und Verluste, können nicht von ihr selbst beantwortet werden, sondern müssen aus ihrem Unbewussten, d.h. aus dem Bereich der Literatur(wissenschaft) beantwortet werden – und zwar im Dialog mit einer neu konzipierten Version der Philosophie, der (kritischen) Theorie.
I-Tsun Wan stellt im dritten Kapitel aktuelle Krisennarrative in den historischen Zusammenhang der krisenhaften Welt um 1800. Seine beispielhafte Lektüre zeitgenössischer literarischer (Kleist) und philosophischer (Schlegel) Positionen zielt dabei auf die Beschreibung einer transzendentalen Geschichtsschreibung, die schließlich eine Überwindung der gravierenden – d.h. ausweglos erscheinenden – Krise ermöglicht. Im Spannungsfeld von Literatur und Wissenschaft, Kommerzialisierung und Religion argumentiert Wan für eine Rückbesinnung auf eine ethisch-religiöse Transzendentalität der Literatur.
Vor dem Hintergrund ›postfaktischer‹ politischer Diskurse (Trump et al.) und solcher Kommentare, die die Schuld für die Untergrabung objektiver Wahrheitsmaßstäbe vor allem bei den linksradikalen Theoretikern der Postmoderne suchen, stellt Christoph Reinfandt in Kapitel vier eine Typologie der gegenwärtigen Wahrheitsbegriffe auf. Anhand von Niklas Luhmanns Modellierung der modernen Gesellschaft als ein sich ausdifferenzierender Zusammenhang autopoietischer, d.h. sich selbst hervorbringender und vorantreibender Kommunikationen, schlägt Reinfandt vor, dass literatur- und kulturgeschichtliche Einsichten einen möglicherweise entscheidenden Schlüssel zum besseren Verständnis der gegenwärtigen Situation bieten können.
In Kapitel fünf geht es Thomas Kater um die Ausdifferenzierung aktueller Krisenzusammenhänge für die Literaturwissenschaft, die sich – möglicherweise zu Recht – genötigt sieht ihre Relevanz in Krisenzeiten zu rechtfertigen. Kater attestiert der Literaturwissenschaft weniger ein Relevanz- denn ein Kommunikationsproblem, lägen ihre Kernkompetenzen doch gerade im schmalen operativen Bereich an der Grenze von Fakt und Fiktion, also im »Modalitätsmanagement« von Texten, das er konkret am Beispiel postfaktischer Auseinandersetzungen in den Social Media (zwischen dem AfD Landtagsabgeordneten Björn Höcke und dem ARD faktenfinder der Tagesschau ) aufzeigt. Statt einer Krise attestiert Kater der Literaturwissenschaft die »Notwendigkeit zur Selbstreflexion im Hinblick auf ihre eigene Relevanz« – sind ihre Kompetenzen doch heute gefragt wie selten zuvor.
Raphael Zähringers Kapitel sechs beginnt die Reihe der Lektürenmit einem Plädoyer für die narratologische Auseinandersetzung mit postfaktischer Politik, die, genau wie Literatur, als »fiktionale Projektionsfläche von Wirklichkeit« gelesen werden kann. Ausgehend von Monika Fluderniks Typenmodell mündlicher Erzählformen und Juri Lotmans Plot-Typologie setzt sich Zähringer mit der »Literaturhaftigkeit« postfaktischer Medientechniken auseinander und kommt zu dem Schluss, dass sich die multimedialen Strukturen postfaktischer Politik mittels literaturtheoretischer Werkzeuge nicht nur beschreiben lassen, sondern dass dies eine sonst kaum führbare Debatte über solche Narrative erst ermöglicht.
In Kapitel sieben setzen sich Robert Leucht und Carl Niekerk anhand konkreter Redebeispiele mit den narrativen Strategien populistischer Politiker (Trump, Blocher, Wilders) auseinander – darunter die Etablierung simplifizierender narrativer Konzepte, z.B. eines »wir«-Gefühls über die Evozierung eines »Volksbegriffs«, dem eine Gruppe von »Feinden« gegenübergestellt wird, oder die Erzeugung von Feindbildern über das Umdefinieren der »Rede des Feindes« für die eigenen Zwecke. Leucht und Niekerk entwickeln so eine Narratologie populistischer Rhetorik, die neue Fragen für die Auseinandersetzung mit derartigen politischen Strategien aufwirft und auch die unausweichliche Frage stellt, was wir als Gesellschaft – und ganz konkret auch die Literaturwissenschaften – diesen Narrativen entgegensetzen können.
Читать дальше