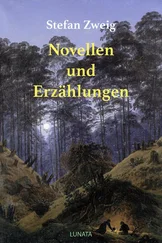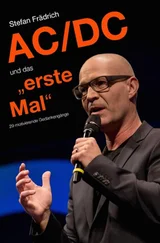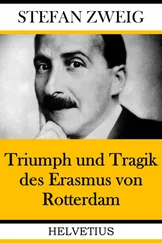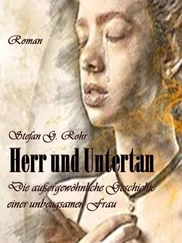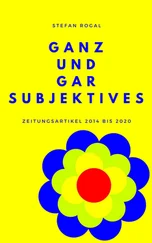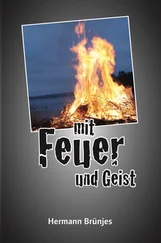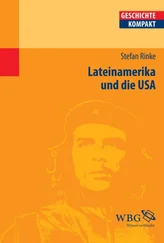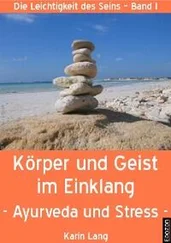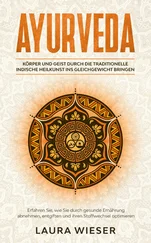Die drei Universalbegriffe des Zeichens bestimmt Peirce einige Jahre später genauer. Wie diese Differenzierungen aussehen, darüber geben die Briefe von Peirce an Welby vom 12.10.1904, vom 23.12.1908 und vom 14.03.1909 sowie Peirces Briefentwurf vom 09.03.1906 Auskunft. Das Objekt gliedert sich danach zweifach in das „dynamische Objekt“ („ Dynamoid Object“19 oder „Mediate Object“20 oder auch „dynamical object“21) und das „unmittelbare Objekt“ („ Immediate Object“).22 Mit dem „dynamischen“ bzw. „mittelbaren Objekt“ ist das „object itself“23 gemeint, während das „unmittelbare Objekt“ der Zeichengestalt entspricht („Its object as it is represented“).24 Die erste Ausprägung des Objektes – das „dynamische Objekt“ oder das „mittelbare Objekt“ – ist zeichenextern, das zweite – das „unmittelbare Objekt“ – zeichenintern.25 Das Verhältnis zwischen beiden Momenten bestimmt sich dadurch, dass das Zeichen durch eine „Andeutung“ („hint“),26 die das unmittelbare Objekt darstellt, das mittelbare Objekt zum Ausdruck bringt („The Sign must indicate it [the dynamical object – S.E.] by a hint; and this hint, or its substance, is the Immediate Object“).27 Das heißt, das unmittelbare Objekt wird funktional (zeichenintern), nicht ontologisch aufgefasst. Hingegen kommt dem dynamischen oder mittelbaren Objekt ontologische Qualität zu („object itself“). Diese ist auch der Grund dafür, dass Wahrnehmungen des externen Gegenstandes entstehen und sich der Zeichen- und Bedeutungsbildungsvorgang („perception“)28 anschließt.29 Das Attribut „dynamisch“ weist gerade auf die Eigenschaft des mittelbaren Objektes hin, einen zeichengebundenen Erkenntnisprozess zu initiieren: „It [the dynamical object – S.E.] means something forced upon the mind in perception, but including more than perception reveals.“30 Das dynamische Objekt zeigt eine erkenntnisbildende Kraft, die zwingenden Charakter hat („forced upon the mind“, „reveals“!). Es will sich sozusagen „selbst mitteilen“.31 Nach Peirces Ansicht gibt es kein dynamisches Objekt, das sich nicht intellektuell erfassen ließe, sonst wäre es nicht real.32 Dieser Ansicht liegt folgender Zusammenhang zugrunde: Dem intellektuellen Gegenstand im menschlichen Geist als Form der Erkenntnis entspricht immer ein Gegenstand in der Außenwelt ( Korrespondenztheorie ). Wahre Erkenntnis ist damit möglich. Die phänomenologische Bestimmung des Übergangs von der Erfahrung zur Erkenntnis – von der Empirie zur Logik – bei Peirce ist dafür der eindeutige Beweis. Im Deutschen lässt sich dieser Zusammenhang mit dem Begriffspaar „Wirklichkeit“ und „Wahrnehmung“ eindrucksvoll veranschaulichen: Ein Objekt ist wirklich, weil es wirkt; weil es wahrgenommen wird, ist es damit auch wahr. Das Objekt beeinflusst den Zeichen- wie den Interpretantenaspekt. Das belegt auch das nachstehende Zitat aus einem Entwurf für ein Schreiben von Peirce an Welby33 deutlich. Das Wortfeld „to determine“ ist für diese Darstellung charakteristisch: „I define a Sign as anything which on the one hand so determines an idea in a person’s mind, that this latter determination, which I term the Interpretant of the sign, is thereby mediately determined by that Object.“34 Hier zeigt sich noch einmal die Relevanz des Aspektes der Relationalität – vor allen Dingen die enge Verbindung zwischen Objekt und Zeichen, die auch in der Begrifflichkeit „mittelbares Objekt“ – „unmittelbares Objekt“ aufscheint35,– sowie die herausgehobene Position des Objektes im Zeichenprozess. Es stellt das die Bedeutungsgenerierung auslösende Moment dar. Peirce bekräftigt in der angeführten Textstelle die Erkenntnisfunktion der Semiose. Dabei lässt sich das mittelbare Objekt nicht vollständig in einem einzelnen Zeichenprozess erschließen, sondern nur in der im jeweiligen Zeichen repräsentierten Hinsicht. 36 Demgegenüber schreibt Peirce dem „Zeichen an sich“ („sign itself“)37 eine seinshafte Gegebenheit zu.38 Es handelt sich um den vielfältig mental erfassbaren Zeichenkörper. Die Beschreibung von „mittelbar“ – also „außen“ – und „unmittelbar“ – „innen“ – stellt die Verknüpfung zwischen Erfahren – Empirie – und Erkennen – Logik – her, die für die phänomenologische Analyse in Peirces Spätphilosophie kennzeichnend ist, wie sich gezeigt hat. Die Grenzen zwischen dynamischem bzw. realem oder mittelbarem Objekt einerseits und Zeichen in seiner Funktion als unmittelbares Objekt andererseits verwischen somit. Objekt- und Zeichenaspekt konvergieren im unmittelbaren Objekt. So ist das unmittelbare Objekt im Grunde nichts anderes als das Zeichen an sich, das das mittelbare Objekt in bestimmter Art verkörpert. Die relationale Struktur des Peirce’schen Zeichenbegriffs wird durch die Konkretisierungen des Objektbezugs vertieft reflektiert und akzentuiert. Reine Logik als Relationenlogik wird in dieser neuen, differenzierten Terminologie transparent. Der „Interpretant“ vervollständigt die Triade und überführt mittelbares und unmittelbares Objekt – Ding und Zeichen – in eine Sinneinheit. Dem Bedeutungsaspekt ordnet Peirce drei Ausprägungen zu: „[…] its interpretant as represented or meant to be understood, its interpretant as it is produced, and its interpretant in itself.“39 Soweit die Definition von 1904. Fünf Jahre später greift Peirce in der Korrespondenz mit Welby die Typen des Interpretanten noch einmal auf und benennt sie jetzt als „Immediate Interpretant“40, „Dynamical Interpretant“41 sowie „Final Interpretant“.42 Wie man erkennen kann, sind alle drei Interpretanten dem Objekt-, dem Zeichen- und dem Interpretantenaspekt zugeordnet, da jede Kategorie von einem deutenden Begriff abhängt. Dies lässt sich aus der folgenden Aussage herauslesen: „The Immediate Interpretant is an abstraction, consisting in a Possibility. The Dynamical Interpretant is a single actual event. The Final Interpretant is that toward which the actual tends.“43 Möglichkeit – „possibility“ – betrifft das Erste – den Objektbezug –, die Formulierung „a single actual event“ verweist auf die spezifische Realisierung – auf das Zweite, den Zeichencharakter –, und die Tatsache der Ausrichtung des Interpretanten („toward which the actual tends“) zeigt das Dritte an. So beschreibt der „unmittelbare Interpretant“ die Deutungsbedürftigkeit – „Interpretability“44, also die jeweilige Bedeutung – eines Zeichens, während der „dynamische Interpretant“ die zugeordnete Reaktion des Interpreten auf den unmittelbaren Interpretanten („actual event“) umfasst: „My Dynamical Interpretant is that which is experienced in each act of Interpretation and is different in each from that of any other; […].“45 Angesprochen ist der Erfahrungskontext („experienced“) – das Moment des Zweiten (vgl. die entsprechende Definition bei Peirce!). Der Begriff „finaler Interpretant“ schließlich bezieht sich einerseits auf das Finden einer angemessenen Bedeutung („toward which the actual tends“), andererseits auf die hypothetisch-futurische vollständige Erschließung eines Objekts, wie das Zitat zeigt: „[…] is the one Interpretative result to which every Interpreter is destined to come if the Sign is sufficiently considered“.46 Für die aufgezählten Formen des Interpretanten führt Peirce ebenfalls noch Nebenbegriffe ein: So wird der „unmittelbare Interpretant“ auch „emotionaler Interpretant“ („emotional Interpretant“) genannt, und der „dynamische Interpretant“ kann als „energetischer Interpretant“ („energetic Interpretant“) bezeichnet werden.47 Anstelle des Syntagmas „finaler Interpretant“ gebraucht Peirce den Begriff „logischer Interpretant“ („logical Interpretant“) oder „normaler Interpretant“ („normal Interpretant“).48 Damit wird das Kategoriensystem im Zeichenmodell dreifach geordnet: monadisch (Zeichen – unmittelbares Objekt), dyadisch (Objekt – mittelbares und unmittelbares Objekt) sowie triadisch (Interpretant – unmittelbarer, dynamischer und finaler Interpretant).
Читать дальше