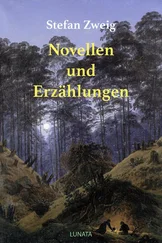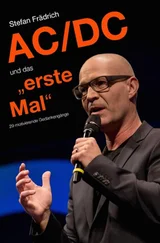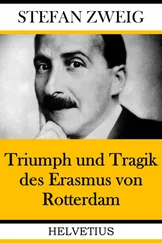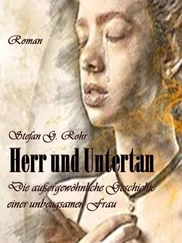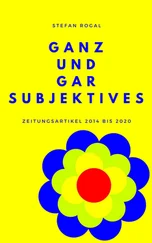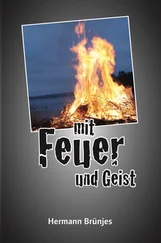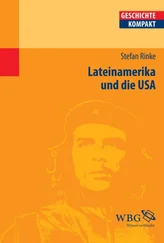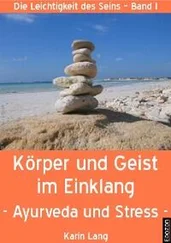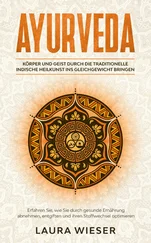Die geschilderte Triade oder triadische Struktur54 bildet – wie gesehen – eine stabile Form. Das Beziehungsgeflecht ist formal-logisch begründet und gestaltet. Die Komplementarität der drei Kategorien manifestiert sich in der Terminologie, denn sie legt eine Reihenfolge fest: Mit der Erstheit beginnt der Erkenntnisprozess. Erstheit wird durch Zweitheit repräsentiert, denn Zweitheit macht das Objekt als solches kenntlich. Zugleich bildet Zweitheit die Voraussetzung für das deutende, dritte Element. Erstheit und Zweitheit bedürfen der Drittheit für die Bedeutungskonstitution.55 So ist also der phänomenologisch interpretierte Erkenntnisvorgang relationenlogisch strukturiert. Diese Relationalität ist die Folge der Bestimmung der drei Kategorien als wissensvermittelnde Entitäten: Erkenntnis heißt, etwas in Beziehung zu setzen. Damit erfassen die drei erwähnten Definitionen in komprimierter Form die wesentlichen Momente des Peirce’ schen Denkens im Hinblick auf sein Kategorienmodell – ontologische Bestimmung, phänomenologisch-logische – also triadische – Gestalt und relationale Ausprägung.56
2.3. Kategorienlehre und Zeichenlehre
Die triadische, phänomenologische Erkenntnisstruktur von Erst-, Zweit- und Drittheit lässt sich ebenso als triadische, semiotische Erkenntnisstruktur interpretieren. Wenn man so will, ist es eine „Übersetzung“ in eine andere „Sprache“.1 Es ist eine andere Darstellungsform. Der Zeichenbegriff wird zum Fundamentalbegriff in Peirces Philosophie. Menschliches Denken kann auch zeichenförmig beschrieben werden. Daher ist der zeichengebundene Erkenntnisprozess analog dem phänomenologischen Erkenntnisprozess zu behandeln. Deshalb geht die Peirce’sche Argumentation im besagten Brief an Welby vom 12.10.1904 auch nahtlos in die Analyse des Zeichenbegriffs über: „In its genuine form, Thirdness is the triadic relation existing between a sign, its object, and the interpreting thought, itself a sign, considered as constituting the mode of being a sign. A sign mediates between the interpretant sign and its object.“2 Das Dritte besitzt eine zweifache Funktion: Es ist einerseits „Interpretant“ – also „Deutung“ oder „Bedeutung“ – und andererseits zugleich selbst wieder ein Zeichen („A sign is a sort of Third“).3 Das oben erwähnte Zitat nennt die drei Größen, die einander zugeordnet sind („mediates“) – das Zeichen sowie das dargestellte Objekt und der Interpretant , der die geistige Größe manifestiert, die Sinn stiftet. Dabei muss beachtet werden, dass sich zwar die deutende Zuschreibung im menschlichen Geist vollzieht, Peirce aber primär nicht das Erkenntnissubjekt im Blick hat, sondern die Erkenntnis an sich. Eco spitzt diesen Zusammenhang treffend zu, wenn er schreibt: „Der Interpretant ist nicht der Interpret.“4
Das Zeichen verkörpert das reine Erste . Zeichen sind Stellvertreter für reale oder mentale Objekte. Ihrer Natur nach sind sie Darstellungen, die zwischen Objekt und Bedeutung vermitteln. Zeichen stehen für etwas – nämlich für das jeweilige Objekt. Es geht darum, eine bedeutungsgenerierende Verbindung zwischen Objekt und Zeichen zu erhalten.5 Dass die Relationalität für die Begriffsbildung essentiell ist, kann man an folgendem Zitat ablesen: „It appears to me that the essential function of a sign is to render inefficient relations efficient, – not to set them into action, but to establish a habit or general rule whereby they will act on occasion.“6 Funktional gesehen kann man ein Zeichen als logische Gesetzmäßigkeit folglich so definieren , dass es eine Bedeutungsgenerierung leisten kann, was nach Peirce ausschließlich in der triadischen Struktur gelingt. Diesen Vorgang der Bedeutungsbildung bezeichnet er als „semeiosis“ – „Semiose“. 7 Die zweite markante und berühmteste Zeichendefinition aus Peirces Theorie findet sich im Syllabus : „A Sign , or Representamen , is a First which stands in such a genuine triadic relation to a Second, called its Object , as to be capable of determining a Third, called its Interpretant , to assume the same triadic relation to its Object in which it stands itself to the same Object.“8 Diese Definition ist prägnant wie evident zugleich: Peirce greift an der Stelle die Synonyma von „Erstheit“, „Zweitheit“ und „Drittheit“ auf, die die Komponenten des Zeichenereignisses – der Semiose – bilden, – nämlich „das Erste“ , „das Zweite“ und „das Dritte“ . Das beweist noch einmal, dass die phänomenologische Betrachtung mit der zeichentheoretischen Untersuchung identifiziert werden kann. Es handelt sich um eine Übertragung von einem logischen zu einem anderen logischen Bereich. Da Peirce allerdings mit dem Zeichen beginnt, vertauscht er in dieser Definition die erste mit der zweiten Position. Er wechselt die Perspektive und entfaltet das triadische Zeichenkonzept vom darstellenden Aspekt her.9 Die ursprüngliche erkenntnistheoretisch-logische Reihenfolge bleibt dennoch erhalten: Begriffsbildung nimmt vom Objekt ihren Ausgang und führt über das Zeichen zu seiner ihm zugeordneten Bedeutung. Dem „Zeichen“ weist Peirce nun den parallelen Begriff „Representamen“ („Repräsentamen“) zu, der die stellvertretende oder darstellende Funktion des Zeichens ins Wort bringt und betont. Gemeint ist damit der Zeichenkörper, das Zeichen an sich.10 Um die Darstellungsfunktion des Zeichens zu komplettieren, ist der Interpretant – also die „Deutung“ oder die „Bedeutung“ – zwingend erforderlich.11 Der Interpretant ist eine geistige Größe: „A Sign is a Representamen with a mental Interpretant.“12
Wesentlich ist der in der Definition zum Ausdruck kommende Aspekt der Selbstreferentialität des Zeichens , den Peirce mehrfach anspricht („A Sign , […], to assume the same triadic relation to its Object in which it stands itself to the same Object“).13 „Selbstreferentialität“ heißt, dass ein Zeichen nur dann als Zeichen verwendet werden kann, wenn es eine weitere dreistellige Struktur impliziert, die ein Zeichen in seiner Zeichenfunktion – die Stellvertretung für ein unabhängiges Objekt – markiert. Ein Zeichen benötigt also immer ein anderes, interpretierendes Zeichen, das seine formale Qualität beschreibt. Zeichen müssen „darstellend darstellen“.14 Ferner ist der Zeichenprozess niemals abschließbar.15 Das gilt grundsätzlich. Der Sachverhalt ist folgender: Ein Interpretant benötigt ein weiteres interpretierendes Zeichen, das die substantielle Qualität – die Bedeutung – des Objektes noch weiter bestimmt und so fort, um sich dem theoretischen Ziel der vollständigen Erkenntnis des externen Objektes immer mehr zu nähern. Auf diese Weise entsteht ein unendliches Netz von Zeichen – ein prinzipiell unabschließbares Zeichenkontinuum ( Kontinuitätsaspekt ). Grundlegend für die Semiose ist also der infinite Regress von Zeichen. Alles ist mit allem verknüpft. Alles ist ein Zeichen ( Totalität bzw. Universalität des Zeichens ).16 Auf das Zeichen lassen sich alle Objekte zurückführen, und mit dem Zeichen lassen sich solche Objekte deuten. Das Zeichen wird bei Peirce zum Fundamentalbegriff.17 In der Realität wird dieser prinzipiell unabschließbare Prozess selbstverständlich abgekürzt, um den Begriffsbildungsprozess für die Kommunikationssituation praktikabel zu halten. Sobald von einem Sprecher nämlich eine hinreichende Bedeutung gefunden ist, beendet er die Suche nach einer weiteren Bedeutung. „Hinreichende Bedeutung“ heißt dabei, dass das zu beschreibende Objekt in seinen wesentlichen Eigenschaften bestimmt ist. Darüber hinaus betont Peirce erneut, dass die Triade sich nicht in eine Dyade auflösen lässt: „The triadic relation is genuine , that is its three members are bound together by it in a way that does not consist in any complexus of dyadic relations.“18
Читать дальше