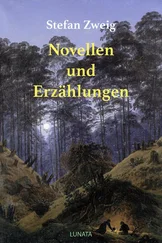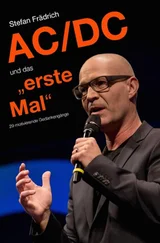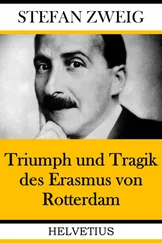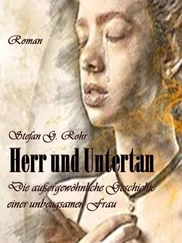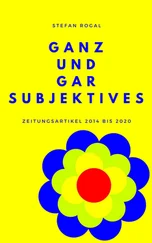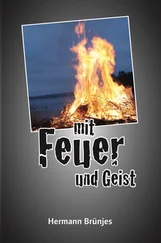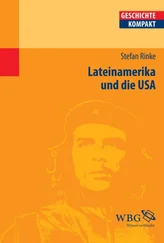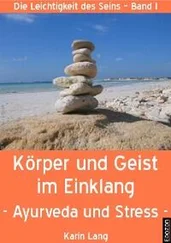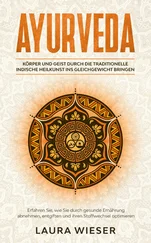Zweitens: Es ist aber auch auf die menschliche Seite zu achten. Zeichen sind deutungsbedürftig, wie bereits oben angeführt. Dass es gerade auch auf die menschliche Ebene ankommt, das manifestiert sich im beständigen Verweis des Evangeliums auf die sozusagen „geistgemäße“ Interpretation der vielfältigen Zeichenhandlungen Jesu. Die Zeichen provozieren den Glauben oder Unglauben der Zeitgenossen Jesu. Die markinische Schilderung vergegenwärtigt diesen Zusammenhang markant ex negativo durch die Stimmen der Gegner Jesu: Der Selbstanspruch Christi auf Vollmacht in seinen Zeichenhandlungen erntet kräftigen Widerspruch bei Schriftgelehrten und Pharisäern (vgl. Mk 3,22–30; 8,11–13). Die Zeichen Jesu sind Offenbarungszeichen Gottes. Seine heilsame Macht wird im wahrsten Sinne des Wortes „begreiflich“. Der Geist – so kann man zusammenfassend formulieren – ist ein „wirkendes Zeichen“. Zeichen ist „Wirk-lichkeit“.
Die Anwendung von Peirces semiotischer Konzeption auf das Markusevangelium soll eine vertiefte Reflexion im Hinblick auf den offenbarungs- und schöpfungstheologischen wie den soteriologisch-christologischen Zusammenhang leisten. Dabei ist auf zwei Aspekte Wert zu legen: Zum einen ist der formale Aspekt zu betrachten: Durch den triadischen Zeichenbegriff lässt sich die Erzählgattung „Evangelium“ in ihrem Offenbarungscharakter auf der Mikro-, Meso- wie vor allem Makroebene profilieren. Aus hermeneutischem Fokus kann der geschilderte semiotische Ansatz von Peirce das mit dem epiphanen Charakter des Markusevangeliums verbundene Schweigegebot als zyklische Struktur bekräftigen und vertiefen. Das Markusevangelium kann dann in seinem Verweisungscharakter der Relecture bestätigt werden.21 Zum zweiten erfolgt die Deutung unter dem materialen Aspekt: Das Zeichenmodell von Peirce expliziert den theologischen Kernbegriff der „Vollmacht“, so dass die Jesusgeschichte noch deutlicher als Heilsgeschichte und damit als „Geistgeschichte“ begriffen werden kann.
Der Geist erschließt sich – als Ruf Gottes –, und er muss erschlossen werden – als menschliche Antwort. Offenbarung ist Kommunikation, die zeichenhaft begegnet und Deutung einfordert. Die Jesusgeschichte ist Heilsgeschichte, und sie wiederum ist „Geistgeschichte“. Der Geist stellt das Verbindend-Vereinende dar; er ist dynamisch-relational zu bestimmen. Der Geistbegriff umfasst damit die Elemente „Wesen“, „Erscheinung“ und „Wirkung“, die in einer Beziehung zueinander stehen. Sie spiegeln die Trias von „Objekt“ oder „Ding“, „Repräsentamen“ oder „Zeichen“ und „Deutung“ bzw. „Bedeutung“ wider, die sich bei Peirce findet. Entsprechend der drei semiotischen Kategorien lassen sich die drei genannten Strukturmerkmale mit dem Vollmachtsaspekt, der den Geistbegriff strukturiert, verbinden: „Vollmacht verleihen“ stellt den „Wesensaspekt“ des Geistes dar – den Dingaspekt –, „Vollmacht ausüben“ bezieht sich auf den „Erscheinungsaspekt“ – also das Zeichenmoment – und „Vollmacht annehmen“ auf den „Wirkungsaspekt“ – die Deutung oder Bedeutung – des Geistes.
So kann eine triadische Matrix erstellt werden, die sich als Ebenenmodell präsentiert – die Mikro-, die Meso- sowie die Makroebene. Die Mikroebene bezieht sich auf das einzelne Sprachzeichen , die Mesoebene auf die Perikope und die Makroebene nimmt das Evangelium als Ganzes in den Fokus. Jede dieser Ebenen ist in sich wiederum triadisch gegliedert. Offenbarungszeichen sind also Geistzeichen, und diese sind zugleich Vollmachtszeichen. Das gesamte Markusevangelium lässt sich daher unter dem expliziten oder impliziten Leitmotiv des „Geistes“ (πνεῦμα) bzw. der „Vollmacht“ (ἐξουσία) – verbunden oder verstärkt durch den Begriff „Vertrauen“ bzw. „Glaube“ (πίστις) – in drei Abschnitte teilen, die mit den Peirce’schen semiotischen Kategorien von „Ding“, „Zeichen“ und „Bedeutung“ korrespondieren. Auf der Makroebene weist das Markusevangelium also eine klare triadische, narrative Struktur auf . Dem Dingaspekt entspricht die Bevollmächtigung Jesu im Taufakt, dem Zeichenmoment die Szenen, in denen Jesus als Lehrer und Wundertäter auftritt, und der Bedeutungsaspekt beschäftigt sich mit den Berichten über Tod und Auferstehung Jesu. Auffällig ist, dass der Ding- wie der Bedeutungsaspekt die göttliche Ebene – die göttliche Intervention – repräsentieren (Geistsendung Jesu, Auferstehung Jesu), während die übrigen Szenen, die das irdische Wirken des Mannes aus Nazaret schildern, auf die menschliche Ebene verweisen – die Reaktionen der Menschen auf die Wort- und Tatzeichen Jesu. Hier ist das Zeichenmoment, das die Vollmacht Jesu umschreibt – in Peirces Diktion die „Darstellung“ („representation“) –, angesprochen. Wie man der Aufstellung der Episoden entnehmen kann, bilden die Kategorien von „Ding“ (vgl. Mk 1,9–13) und „Bedeutung“ (vgl. Mk 15,33–39; 16,1–8) einen engbegrenzten Rahmen, der Gesichtspunkt „Zeichen“ entfaltet sich hingegen in einer ausführlichen erzählerischen Darstellung. Zur genauen Bearbeitung sollen aus dem Markusevangelium paradigmatische Szenen ausgewählt werden, die nachstehend aufgezählt und knapp kommentiert werden:
1. Makroebene: „Vollmacht verleihen“ (Dingaspekt und Wesensaspekt):
Meoebene MK 1,9–11; 1,12f. (vgl. Tabelle 1 unten):
Begonnen werden soll mit den beiden Perikopen über die Taufe und Versuchung Jesu, die in einem inneren Zusammenhang stehen und ein kompositorisch-theologisches „Diptychon“ ergeben (vgl. Mk 1,9–13), das die Aussage verstärkt. Die wesentlichen Strukturelemente werden den Aspekten „Ding“ („Taufe Jesu im Jordan“ – „Gang Jesu in die Wüste“), „Zeichen“ („Herabkunft der Taube / des Geistes“ – „Versuchung Jesu durch den Satan“), „Bedeutung“ („Stimme Gottes [Verheißung]“ – „eschatologische Szene [Erfüllung: Tierfrieden, Engelsdienst“) zugeordnet. Entsprechend ist mit den übrigen Perikopen zu verfahren.
2. Makroebene: „Vollmacht ausüben“ (Zeichenaspekt und Erscheinungsaspekt:)
Auf dieser Ebene sollen paradigmatisch für die unterschiedlichen Zeichenformen Jesu jeweils ein Streitgespräch, ein Exorzismus, eine Wunderheilung sowie die Totenauferweckung der Tochter des Jaïrus besprochen werden. Auch diese Szenen lassen sich, wenn sie nicht schon ohnehin – wie im Fall von Mk 5,21–43 – als Doppelperikope konzipiert sind, als Diptychon darstellen.
Mesoebene 1: Mk 3,22–30; 5, 1–20 (vgl. Tabelle 2 unten) :
Dem Dingaspekt zuzuweisen sind folgende Komponenten: „Bestreiten der Vollmacht Jesu durch die Schriftgelehrten“: „widergöttliche Macht“ – „Bezeugen der Vollmacht Jesu durch die Dämonen“: „göttliche Macht“. Hinsichtlich des Zeichenaspektes gilt: Die Gleichnisrede Jesu steht den Zeichen der Besessenheit – den „Zeichen des Unheils“ – und den Zeichen des Exorzismus – den „Zeichen des Heils“ – entgegen. Den Bedeutungsaspekt repräsentiert das Element „Erweis der Vollmacht.
Mesoebene 2: MK 5,21–43 (vgl. Tabelle 3 unten):
Die Doppelperikope gliedert sich in semiotischer Hinsicht wie folgt: Dem Dingaspekt entsprechen zum einen die Strukturmerkmale des Herantretens des Jaïrus an Jesus mit der Bitte um Heilung der todkranken Tochter sowie der durch die Boten überbrachte Tod des Mädchens und zum anderen die Beschreibung der Krankheit der Frau, das heimliche Herantreten der Frau an Jesus sowie das Verhalten der Frau nach der Entdeckung der Wunderheilung. Der Zeichenaspekt kommt in einer Reihe von Kennzeichen zum Ausdruck: „Berührung des toten Kindes durch Jesus“ – „Berührung des Gewandes Jesu durch die kranke Frau“, „Erweckung der Tochter des Synagogenvorstehers durch Jesus“ – „Heilung der Frau durch Jesus“. Hinsichtlich des Bedeutungsaspektes stehen die Elemente „Appell zum Glauben“, „Reaktion Jesu“, „Unverständnis des Hausstandes“, „Rückkehr des Mädchens ins Leben“, „Schrecken der Zeugen“ und „Schweigegebot Jesu“ parallel zur „Überlegung der Frau“, zur „Reaktion Jesu“, zum „Unverständnis der Jünger“, zum „Lob des Glaubens der Frau durch Jesus“ und zum „Wegschicken der Frau“.
Читать дальше