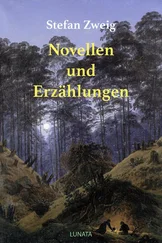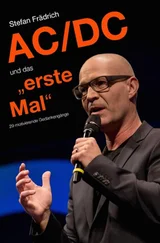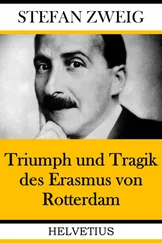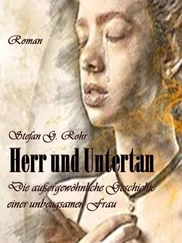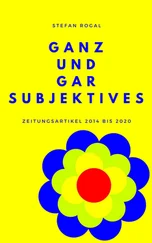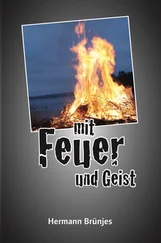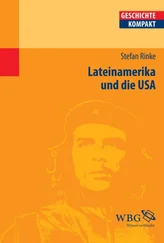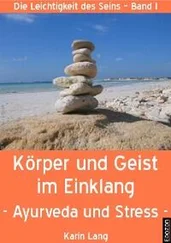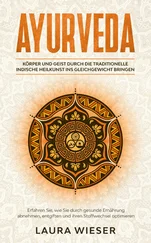Zusammenfassend lässt sich also sagen: Der Vollmachtsbegriff stellt ein Synonym für den Geistbegriff dar. Diese Vollmacht manifestiert sich in Zeichen, und zwar – wie Mk 1,21–28 eindrücklich zeigt – in Wort- und Tatzeichen. Der Vollmachtsbegriff bleibt daher wie der Geistbegriff nicht schwebend-unbestimmt. Der Text Mk 1,21–28 ist daher als Zwischenstück zu begreifen, das die in Mk 1,14–15 proklamierte Königsherrschaft Gottes mit erzählerischen Mitteln zum Ausdruck bringt.20 Dabei weist die Tatsache, dass der Beginn des Wirkens Jesu in der Synagoge von Kafarnaum stattfindet, auf die tiefe Verbundenheit zwischen JHWH und Jesus und damit auf die Verbindung zwischen Gottes Allmacht und Jesu Vollmacht hin. Es handelt sich bei Mk 1,21–28 evident um eine Szene der Offenbarung göttlicher Schöpfermacht; die Schriftauslegung und die Dämonenaustreibung sind Zeichen der Vollmacht Jesu und damit zugleich Zeichen der Allmacht Gottes, die sich nun in seiner beginnenden Königsherrschaft Bahn bricht. Die programmatische Stelle hat einen sowohl abschließenden wie eröffnenden Charakter, denn sie deutet einerseits Jesus von Nazaret als geistbegabten, bevollmächtigten Sohn Gottes (vgl. Mk 1,1. 11) – somit als den von Israel erhofften Messias – und leitet andererseits zugleich über in die Erzählung über das Wirken Jesu.
4. Erscheinung und Offenbarung
4.1. Zeichen und Wirklichkeit
Das Offenbarungsgeschehen ist also ein Ereignis, das der Geist Gottes be wirkt, und durch das der göttliche Geist auf den menschlichen Geist ein wirkt. Der Geist bildet die verbindende und vereinende Entität. Damit entspricht der theologische Geistbegriff, der sich offenbarend-schöpferisch zeigt, dem dynamisch-relational strukturierten, semiotischen Zeichenbegriff. Daher erscheint es auch als legitim, die Geistthematik anhand der von Peirce entwickelten kategorial-semiotischen Hermeneutik zu analysieren und zu interpretieren.
Peirces Semiotik hat bislang in der Theologie im Allgemeinen und in der Exegese im Besonderen noch wenig Resonanz gefunden. Von systematischer und religionsphilosophischer Seite ist im deutschsprachigen Raum Hermann Deuser1 zu nennen. In exegetischer Hinsicht hat Stefan Alkier die semiotischen Grundzüge Peirces für die bibelwissenschaftliche Arbeit fruchtbar gemacht. Genannt sei an dieser Stelle zunächst seine Monographie von 2009 zum Verständnis der Auferweckung,2 in der er einen Abschnitt der semiotischen Deutung der Auferweckungszeichen im Peirce’schen Sinne widmet3 und dabei „Phänomene der Erstheit“ („Zweifel, Furcht, Tränen, Freude und brennende Herzen“)4, „Phänomene der Zweitheit“ („Kreuz, Grab und Visionen“)5 sowie „Phänomene der Drittheit“ („Die große Erzählung der Schrift[en] als epistemologischer Rahmen der Rede von der Auferweckung“)6 ausmacht. Speziell zum Thema „Geist“ hat Alkier einen Aufsatz veröffentlicht, der Geist als Erfahrung der δύναμις mit dem „dynamischen Objekt“ in Peirces Zeichentheorie verknüpft:7
Ich möchte nun vorschlagen, die Kraft ( dynamis ) des dynamischen Objekts als Geist zu interpretieren. Es ist die unverfügbare Kraft, die notwendig ist, überhaupt einen Zeichenprozess, eine Semiose, in Gang zu bringen. Das unmittelbare Objekt ist dann der Aspekt des dynamischen Objekts, der in der jeweils konkreten Semiose durch den Akt der Interpretation bestimmt wird. Geist ist dann zeichentheoretisch abstrakt bestimmt als die unverfügbare Wirkkraft, die das Zeichen überhaupt erst motiviert und seine konkreten Interpretationen als solche überhaupt erst ermöglicht. Im Akt der jeweiligen Interpretation wird diese Wirkkraft dann jeweils konkret bestimmt und damit interpretierend erschlossen.8
Alkier rückt also das „Objekt“ ins Zentrum seiner Überlegungen. Diese These verdeutlicht er in der Folge anhand markanter neutestamentlicher Beispiele. Dabei setzt er seinen Schwerpunkt auf die paulinische Theologie – auf die Deutung des Evangeliums und des Glaubens als Kraft Gottes (vgl. Röm 1,16),9 auf das Wort vom Kreuz10 sowie auf die Abendmahlsüberlieferung.11 Theologisch gesprochen bedeutet das: Der Geist Gottes lässt sich im Sinne Peirces als vorausliegende, unverfügbare und kreative Größe interpretieren, die auf den Menschen wirkt, indem sie ihn verwandelnd berührt und somit für die göttliche Heilsbotschaft der Auferstehung von den Toten öffnet.12 Alkier resümiert: „Der Glaube versteht sich dann nicht als autonome Entscheidung eines souveränen Subjekts, sondern als Ergriffensein vom Geist Gottes, als Geschenk, als gelungene Kommunikation zwischen Gott und Mensch.“13 Es entstehe daher – so Alkier – ein vertieftes Verständnis des Bibeltextes als Vordringen in die Tiefenstruktur des Textes – „Sinn in der zweiten Potenz“ –, nicht ein bloßes Begreifen der grammatisch-semantischen Oberflächenstruktur des Textes – „Sinn in der ersten Potenz“.14
Angestoßen von diesen Anregungen möchte die vorliegende Untersuchung die Geistthematik semiotisch-exegetisch neu bedenken und thematisch erweitern.15 Während Deuser in seinem Beitrag das relationale Moment akzentuiert,16 hebt Alkier in derselben Publikation auf den dynamischen Aspekt ab.17 In der hier vorgelegten Arbeit sollen beide Momente zusammengeführt und als „dynamisch-relationaler Sinnzusammenhang“ bzw. „dynamisch-relationales Sinngefüge“ oder „dynamisch-relationales Deutungsmuster“ verstanden werden. Den Grund für diese Annahme bot die Untersuchung der Peirce’schen Kernthesen, vor allem aus seinem Spätwerk, die zeigen konnte, dass sich die beiden Elemente der Dynamik und der Relationalität komplementär zueinander verhalten. Relationalität ist Ausdruck – sozusagen „Zeichen“ – der Dynamik, die auf Erkenntnis gerichtet ist. Der Erkenntnisprozess repräsentiert eine Einheit, die man nicht zerteilen kann. Dies gilt auch für die Anwendung des semiotischen Komplexes auf den theologischen Kontext des Offenbarungsprozesses. Grundlage der Arbeit soll die Auslegung des Markusevangeliums im Hinblick auf die darin vorfindlichen Geistaussagen sein. Es sind dabei zwei Aspekte zu beachten – die göttliche und die menschliche Ebene:
Erstens: Im Hinblick auf die göttliche Seite schildert das Markusevangelium die Geschichte Jesu (vgl. Mk 1,1) als Beginn der evolutiv-dynamisch verstandenen Königsherrschaft Gottes – der βασιλεία τοῦ θεοῦ.18 Die Verleihung des göttlichen Geistes an Jesus von Nazaret in der Taufe im Jordan (vgl. Mk 1,9–11) setzt dafür den schöpferischen Anfang (ἀρχή – vgl. Mk 1,1).19 Das ist – im jesuanischen Gleichniswort gesprochen – das kleine Senfkorn, das zur großen Staude heranwächst (vgl. Mk 4,30–32). So zeigt sich der irdische Jesus seit seiner Taufe (vgl. Mk 1,9–11) als Geistträger und damit als „Christus“ und „Sohn Gottes“ (vgl. Mk 1,1. 11). Es ist die bewusste theologische Entscheidung des Markus, die Vermittlung des Geistes mit dem Gedanken der Königsherrschaft Gottes im ambiguen Terminus „Anfang“ – als Zeichen des Beginns des Evangeliums und als theologische Spitzenaussage zugleich20 – bereits im ersten Vers seines Evangeliums zu verknüpfen. Im Geist verbindet sich Gott mit dem Menschen Jesus, und dieser begegnet seinen Mitmenschen. Das Offenbarungsereignis gestaltet sich als beständige Interaktion zwischen Gott und Mensch durch den geistbegabten Mittler Jesus Christus. Geist Gottes und die Person Jesu verbinden sich in ihrer Vermittlungsfunktion. Der Geistbegriff ist untrennbar mit dem Vollmachtsbegriff verbunden. Als Geistträger repräsentiert Jesus daher in seiner Person die Vollmacht – die ἐξουσία – Gottes. So zieht Jesus in Galiläa umher, lehrt, heilt und treibt im Geist Gottes Dämonen aus. Er handelt stellvertretend für Gott – wirkt also im Namen Gottes. Die Worte und Taten Jesu sind vollmächtige Zeichen der Präsenz Gottes. Zeichen als äußeres Moment und Vollmacht bzw. Geistbesitz als inneres Moment werden miteinander verbunden. Machtvolle Zeichen sind der untrügliche Ausweis göttlichen Auserwähltseins oder widergöttlicher Bevollmächtigung. In den im Geist Gottes vorgenommenen Offenbarungszeichen Jesu wird Gott anschaulich.
Читать дальше