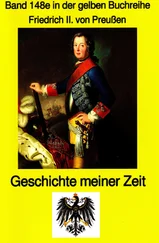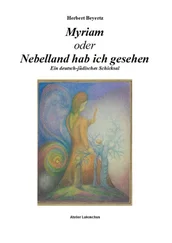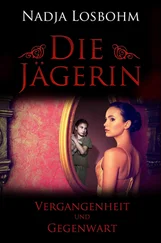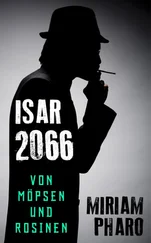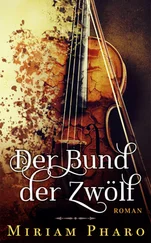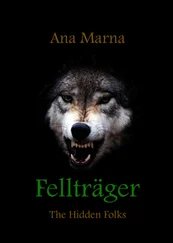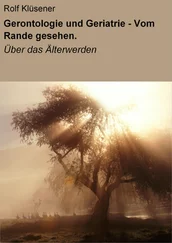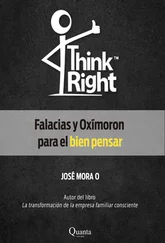»Nur durch ein aufwändiges Zusammenspiel von Routinen und Gemeinsamkeit, Verlässlichkeit und Flexibilität lässt sich noch ein gemeinsames Familienleben etablieren. In diesem Rahmen nehmen die Medien vielfältige unterstützende, zum Teil – so unsere These – konstitutive Funktionen für das Doing Family in symbolischer und praktischer Hinsicht ein«28.
Der Terminus »Doing Family« rekurriert dabei auf »Familie als Herstellungsleistung«29. Die damit anskizzierte aktive und agitatorische, konstruktive Vorstellung von Familie »umfasst Prozesse, in denen in alltäglichen und biografischen Interaktionen Familie als sinnhaftes gemeinschaftliches Ganzes hergestellt wird.«30
In der vorliegenden Arbeit wird konzeptionell von einer » Medienkultur «31 ausgegangen – getreu dem berühmten Ausspruch Siegfried J. Schmidts: »Das Programm Kultur realisiert sich als Medienkultur, und man könnte fast hinzusetzen: und als nichts anderes.«32 So ist auch mit Scheffer erstens davon auszugehen, dass »hauptsächlich Medien […] zur Subjektbildung bei[tragen]«33 und zweitens zu betonen, dass »Realitätserfahrung […] überhaupt erst durch eine vorauslaufende mediale Bearbeitung erzeugt und ermöglicht [wird]«34, wobei der Terminus »›Medialität‹ im Sinne von ›grundsätzlich vermittelt‹«35 zu gebrauchen ist. Auszugehen ist also von einer Synchronizität von Medien/Medialität und Lebenspraxis.
Synchronizität von Medialität und Familialität kommt beispielsweise in einem Artikel im Magazin der Süddeutschen Zeitung zum Ausdruck. Simultan zur Injektion von Samen in die Vagina bei einem assistiert reproduktiven Verfahren soll das Lied Eye Of The Tiger abgespielt werden:
»Die Spritze mit dem Spendersperma, das sterile Behandlungszimmer, die sachliche Ärztin – das war alles so unromantisch, so wenig feierlich. Darum hatte Kate Elazegui ein Lied mitgebracht. Als die Ärztin ansetzte, den Samen in Kates Vagina zu injizieren, gab sie ihr das vereinbarte Handzeichen, Kate drückte auf die ›Play‹-Taste, lehnte sich zurück und hörte: Eye Of The Tiger.«36
Besonders deutlich ist jene Synchronizität von Medien/Medialität und Lebenspraxis mit familienpolitischem Bezug in einer Sequenz aus Die Pinguine aus Madagascar 37 (Penguins of Madagascar, USA 2014, Regie: Eric Darnell und Simon J. Smith, DreamWorks Animation; DVD) inszeniert. Vor einigen Jahren – so gibt es der Animationsfilm vor – rollte ein einzelnes Pinguin-Ei, zuvor vom Schnee verdeckt in seltsam anmutender Reminiszenz an Social Freezing (Einfrieren von Eizellen), eine abschüssige eisige Landschaft in der Antarktis hinunter. Spuren, ja Lebensspuren im Schnee hinterlassend, atemberaubend schnell vorbei an der possentreibenden Pinguin-Karawane, darunter Skipper, Kowalski und Rico. Wie bei allen kulturell relevanten Ereignissen der Gegenwart ist auch innerhalb der filmischen Diegese ein Kamerateam synchron zu den Vorgängen anwesend (P 00:02:25).
Die diegetisch-sichtbare Synchronizität von Medien/Medialität und Lebenspraxis reflektiert unser medienbezogenes Handeln in unserer Medienkultur. Michaela Ott geht diesbezüglich davon aus, dass »unübersichtliche Durchdringungsverhältnisse zwischen medialen Artikulationen und in sie verschlungenen menschlichen Handlungs- und Äußerungsweisen«38 bestehen.
Auf die (kindliche) Frage, ob das den Abhang hinabrollende Ei zurückgeholt werden solle, antwortet ein (erwachsener) Pinguin:
»Tut mit echt leid, Kleiner. Jedes Jahr verlieren wir ein paar Eier – so ist das eben in der Natur« (P 00:02:27).
Die (kindliche) Gegenrede lautet:
»Oh klar, die Natur. Das macht irgendwie Sinn, aber irgendwas irgendwas tief in meinem Innern sagt mir, dass das überhaupt keinen Sinn macht. Wisst ihr was: Ich lehne die Natur ab« (P 00:02:31).
Diegetisch folgt eine pinguineske Geburtshilfe: gefährlich, lebensgefährlich, aufregend, auf Eisbergs Schneide, emotional und medial angestoßen durch einen gewaltigen Stoß des Mikrofons vom Medienteam. Inszeniert wird eine performativ hergestellte Form von Familie, wobei die konventionelle duale und zweigeschlechtliche Elternschaft (Mutter-Vater, männlich-weiblich) unterlaufen wird. Der Startschuss der Geburt, das Zerbrechen der Schale und das Schlüpfen des Pinguin-Babys (Private genannt) ist künstlich (obschon durch ein Missgeschick) herbeigeführt. Ein unabsichtlicher Flügelschlag (nicht etwa eine Blasensprengung oder die Verabreichung bestimmter Hormone) initiiert das »Wunder der Geburt« (P 00:05:52) – nicht ohne Ironisierung romantisch-ästhetisierender Geburtsvorstellungen. Abgelehnt wurde die Natur: Aber was nun? Wo ist die Mutter, der Vater, die Familie? Wer ist die Mutter, der Vater, die Familie? Die Pinguine können sich wohl auf ein emotionales Band einigen, vermutlich eine Form der sozialen Elternschaft:
»Du hast uns, wir haben einander, und wenn das keine Familie ist, dann weiß ich auch nicht« (P 00:06:37).
Die hier zugrunde liegende Annahme einer konstitutiven Verschachtelung von Medien im weiten Sinn und Kultur als Medienkultur sensu Siegfried J. Schmidt kann nicht auf eine Haltung hinauslaufen, die sich mit der Untersuchung verschiedener Aushandlungen »in den Medien« begnügt. Eine solche Haltung würde nämlich erstens einer präjudizierten Einschränkung auf bestimmte Medien, häufig immer noch subtil durch Qualifikationen wie fiktiv , real , technisch , hoch und niedrig geprägt, Vorschub leisten. Zweitens impliziert der Ausdruck »in den Medien« ein latent inhärentes Verbot, Medien jedweden Status und Kultur konstitutiv zusammenzudenken. Angeknüpft werden kann vielmehr an diejenige Forschung zum Themenkomplex Geburt/Familie/Reproduktionstechnologien, die stets auf Grenzverwischungen zwischen Realität und Fiktion, Wissenschaft und Kunst sowie auf die enorme Bedeutung der Medien, Medialität, Diskursivität und Kulturalität verweist (siehe Forschungsüberblick, exemplarisch seien hier Dreysse und Nusser genannt), wobei über den Begriff Medienkultur und die mediensyntagmatische Haltung, in die auch unorthodoxe Medien inkludiert sind, dennoch zu bereits existierenden Untersuchungen eine erkenntnispraktische Verschiebung erfolgt, die noch erläutert wird. Drittens kann der Mediengebrauch nur aktiv sein39. Hier wird ein weiter Medienbegriff40 präferiert. Die Annahme einer Medienkultur führt zu neuen und anderen Erkenntnissen rund um Familienpolitik, indem konzeptionell vielfältige Medien und Kultur zusammengedacht sind. Auf der Grundlage eines konstitutiven Zusammendenkens von Medien und Lebenspraxis kann gerade auf einer ersten Ebene weder eine qualitative Separation (»die Medien«) und Subordination (»indirekt«) noch eine kanalisierende Wirkung (»durch die Medien«) von Medien angenommen werden:
»Die öffentliche Meinung spielt eine große Rolle im Zusammenhang mit der Entscheidung, ob eine Schwangerschaft fortgeführt oder beendet werden soll. Diese kann direkt vertreten werden durch den Partner, die Familie, die beratenden GenetikerInnen/ÄrztInnen oder auch indirekt durch die Medien [Hervorhebungen M.P.].«41
Grundlage der vorliegenden Arbeit sind hingegen medienkulturelle Arrangements. Dazu gehören neben Literatur und Filmen auch Facebook-Kommentare, eine Messe-Topografie oder ein Kalender. Mit Bernd Scheffer gehe ich davon aus, dass »Kunst und Literatur […] (bestenfalls) auf herausgehobener Bühne das Spiel [spielen], das überall stattfindet« 42. Betont werden soll damit die stets konstruktive Gestaltungspraxis, oder weniger neutral – keinesfalls aber kokett –, das buchstäbliche, stets vorhandene medial-performative Spiel, gerade auch im Kontext von Familie. Thomä konturiert beispielsweise Elternschaft als verlängerte Theaterprobe, als alltägliches Abenteuer: »Elternschaft hat vielleicht noch am ehesten – jedenfalls was die Unübersichtlichkeit betrifft – etwas von einer Theaterprobe, die nicht enden will; sie ist ein Abenteuer des Alltags.«43 Für dieses Abenteuer, für familiale Identitätsentwürfe werden unterschiedliche Medien benötigt:
Читать дальше