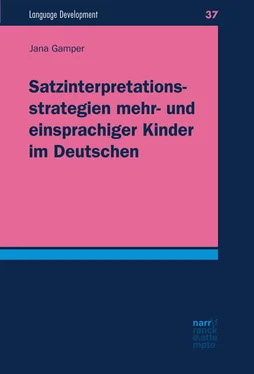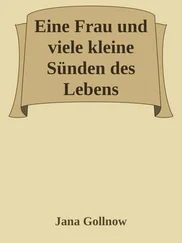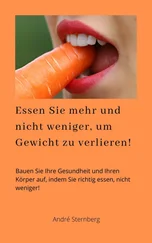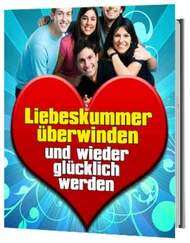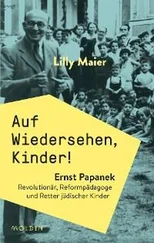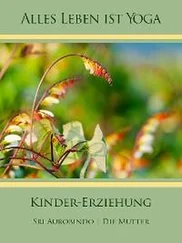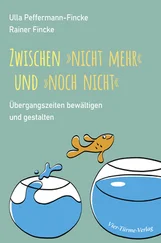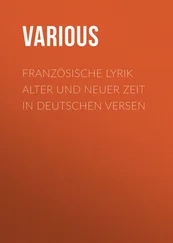Hoppers zunächst vage erscheinende Definition fasst grundlegende funktionalistische Vorannahmen zusammen. So ist die Emergenzthese keinesfalls so zu verstehen, dass Sprecher in spezifischen Interaktionssituationen die lineare grammatische Struktur immer wieder neu aushandeln müssten. Vielmehr geht aus dem Zitat hervor, dass die Verwendung einzelner Strukturen kontextgebunden sein muss und die an der Interaktion Beteiligten spezifisches Wissen über die Funktionen der gebrauchten Strukturen mitbringen müssen, um Inhalte kommunizierbar und verstehbar zu machen. Grammatik entsteht also in und durch Interaktion und ist damit quasi doppelt gebrauchsbasiert. Für den Spracherwerb ist hier besonders der Aufbau grammatischen Wissens aus dem Gebrauch heraus entscheidend. Erwerbstheoretische Ansätze gehen zwar davon aus, dass Erwerbsprozesse systematisch, jedoch nicht linear verlaufen (vgl. Ellis/Larsen-Freeman 2006: 562). Die fehlende Linearität und daraus resultierende Variabilität im Erwerbsverlauf ist wiederum eine direkte Abbildung eines emergenten, das heißt schrittweisen Aufbaus eines lernerspezifischen grammatischen Wissens. Vorausgesetzt wird hierbei, dass die ausgebildete Systematik auf interaktionalen Erfahrungen und damit auf einem spezifischen sprachlichen Input basiert. Die gebrauchsbasierte Orientierung gepaart mit kognitiven Fertigkeiten, die Erwerb überhaupt erst ermöglichen, fasst Tomasello (2005: 41) folgendermaßen zusammen: In this process [i.e. the grammatical development, JG] children do two things simultaneously. First, they extract from utterances and expressions such small things as words, morphemes, and phrases by identifying the communicative job these elements are doing in the utterance or expression as a whole. Second, they see patterns across utterances, or parts of utterances, with “similar” structure and function, which enables them to create more or less abstract categories and constructions. These are the two faces of grammar: smaller elements and larger patterns. Tomasello stellt hier drei zentrale Komponenten heraus: Spracherwerb ist zunächst als Grammatikerwerb zu verstehen, der wiederum funktional motiviert ist. Welche grammatischen Muster und Strukturen wiederum welche Bedeutungen transportieren, wird aus der Interaktion mit unterschiedlichen Gesprächspartnern abgeleitet. Die Extraktion von Form-Funktions-Relationen ist, so lässt sich folgern, gebunden an Gebrauch. Damit überhaupt etwas aus dem die Lerner umgebenden Sprachgebrauch extrahiert werden kann, werden Äußerungen nach spezifischen Kriterien systematisch analysiert. Lerner sind dabei auf der Suche nach Mustern ( patterns) und Regelmäßigkeiten, die sie wiederum nur auffinden können, indem sie einzelne Strukturen zu größeren Einheiten bündeln (das heißt Kategorien bilden) und diese Einheiten letztlich zu größeren, bedeutungstragenden Mustern beziehungsweise Schemata abstrahieren. Dabei muss ergänzt werden, dass Lernern nicht nur die erwähnten kognitiven Fertigkeiten der Kategorisierung, Analogiebildung und Abstrahierung zum Auffinden von Mustern zur Verfügung stehen, sondern dass diese durch implizites statistisches Lernen determiniert werden. Kidd (2012: 172) definiert dieses „as the largely or wholly unconscious process of inducing structure from input following exposure to repeated exemplars“. Dass Lerner also überhaupt Muster entdecken können, wird durch die grundlegende kognitive Fertigkeit der statistischen Analyse von Input ermöglicht. In Bezug auf die Ausbildung von Form-Funktions-Paaren heißt das, dass Lerner analysieren, wie oft eine spezifische grammatische Struktur als zuverlässiger Indikator für den Ausdruck spezifischer Inhalte verwendet wird. Frequenz und Reliabilität von Mustern spielen deshalb eine zentrale Rolle im Erwerb. Spracherwerb im Sinne eines emergenten Prozesses würde in diesem Zusammenhang bedeuten, dass Lerner Schritt für Schritt ein grammatisches System aufbauen. Diese Annahme ist zugleich das Credo einer konstruktivistischen Sicht auf Spracherwerb: „Language structure […] is constructed by the child, either in the context of pragmatically elaborate communicative contexts […] or as an extension of conceptual understanding, which is the logical precursor to language“ (Hollich et al. 2000: 149). Aus konstruktivistischer Perspektive ist dieser Gedanke so zu verstehen, dass Lerner sich auf zweierlei Art und Weise entwickeln. Ihre kommunikativen Kontexte und damit Bedürfnisse werden genauso stetig ausgebaut wie ihr konzeptuell-semantisches Wissen, das wiederum den Ausbau des sprachlichen Repertoires erfordert. Vereinfacht lässt sich sagen: Entwickelt sich ein Lerner, entwickelt sich auch seine Sprache. Entwicklung heißt wiederum Veränderung, sodass Spracherwerb im Sinne der Emergenzthese eine kontinuierliche und systematische Weiterentwicklung formal-funktionaler mappingsbedeutet. Zusammenfassend lässt sich folgern, dass ein funktional motivierter Blick auf Grammatik stets ein Zusammenspiel zwischen pragmatischen und semantischen Faktoren und ihrer Abbildung auf formalsprachliche Strukturen annimmt. Erweitert um die kognitive Sicht sind dabei sowohl semantische Konzepte als auch die jeweilige sprachliche Struktur mental repräsentierte er Einheiten, die in einem symbolischen Verhältnis stehen. Die Beherrschung einzelsprachlicher Form-Funktions-Paare ist aus einer Erwerbsperspektive das primäre Erwerbsziel. Aufbauend auf spezifischen kognitiven Mechanismen wie Kategorien- und abstrakter Musterbildung sowie implizit-statistischem Lernen wird Sprechern das Auffinden grammatischer Muster ermöglicht. Im Erwerbsprozess verändern sich mit dem Ausbau kommunikativer Bedürfnisse und semantischer Konzepte (die wiederum vor allem im L1-Erwerb von der kognitiven Entwicklung abhängig sind) die Verknüpfungen zwischen Formen und Funktionen. Je mehr Informationen ein Lerner erhält, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass bestehende Verknüpfungen zwischen grammatischen Formen und ihren jeweiligen Funktionen modifiziert und erweitert werden. Die Fragestellungen der Arbeit lassen sich vor dem Hintergrund dieser Grundannahmen nun weiter spezifizieren. In erster Linie soll es darum gehen, Form-Funktions-Paare bei Lernern mit unterschiedlichen sprachlichen Vorerfahrungen und damit mit variierenden mappingszu identifizieren. Mit Blick auf den Givón’schen Ikonizitätsbegriff soll ermittelt werden, ob Lerner syntaktische Muster sowie andere formalsprachliche Mittel (hier: Kasusmarker) mit konkreten semantischen Konzepten verbinden. Die Existenz mehrerer Kodierungsmöglichkeiten für eine Funktion ist Resultat des many-to-one-mappings, wodurch eine potentielle Konkurrenz zwischen syntaktischem Muster und Kasusform hervorgerufen wird. Mit Blick auf die Annahmen der emergenten Grammatik, die davon ausgeht, dass Lerner im Zuge ihrer sprachlichen Entwicklung ein grammatisches System schrittweise und systematisch konstruieren, sollte dieser Umstand dazu führen, dass sich die Verknüpfung zwischen Formen und ihren potentiellen Funktionen sukzessive verändert. Ziel der Arbeit ist es deshalb herauszufinden, welche mappingsmehrsprachige Sprecher in der L2 Deutsch aufbauen und inwiefern sich diese mappings(insbesondere unter dem Einfluss der jeweiligen Ausgangssprache) von denen einsprachiger Sprecher unterscheiden. Weiterhin soll geklärt werden, ob und wie sich diese Form-Funktions-Paare im Kontext der Emergenzthese verändern. Die Veränderung, so die übergeordnete These, bildet letztlich den Weg zum Erwerbsziel ab, der (unabhängig von der Ein- respektive Mehrsprachigkeit von Sprechern) darin besteht, Kasusmarker im Deutschen als zuverlässige Indikatoren für semantische Relationen in transitiven Sätzen zu nutzen. 2.2 Form-Funktions-Relationen im Deutschen, Niederländischen und Russischen Um herausarbeiten zu können, welche sprachlichen Mittel in den hier untersuchten Sprachen als Indikatoren für semantische Relationen fungieren, werden im Folgenden die dem Deutschen, Niederländischen und Russischen zugrundeliegenden Kodierungsprinzipien skizziert.
Читать дальше