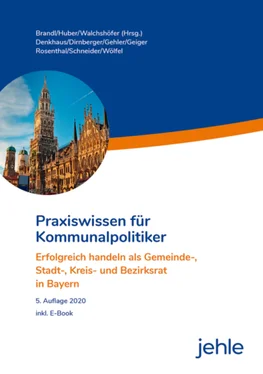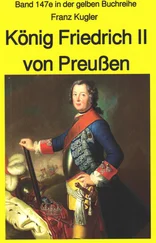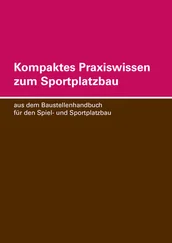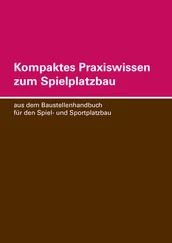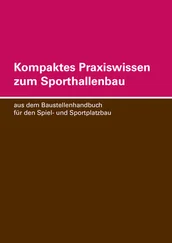Europäische Gemeinschaften
1957 beschlossen die sechs Länder Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande die Zusammenlegung ihrer Wirtschaft und die Einrichtung eines gemeinsamen Entscheidungsgremiums in Wirtschaftsfragen. Hierzu gründeten sie die drei Organisationen: die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), die Europäische Atomgemeinschaft (Euratom) und die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG). Diese sind als die Europäischen Gemeinschaften bekannt. Die EWG wurde bald die wichtigste Organisation. Mit Inkrafttreten des Vertrages von Maastricht 1993 wurde aus der EWG die Europäische Gemeinschaft (EG), die die Grundlage der heutigen Europäischen Union (EU) bildet.
Die Kommission ist das Initiativ- und Exekutivorgan der EU. Sie ist politisch unabhängig und vertritt die Interessen der EU, indem sie Rechtsakte, Politikbereiche und Aktionsprogramme vorschlägt und für die Umsetzung der Beschlüsse von Parlament und Rat sowie für die Haushaltsverwaltung verantwortlich ist. Die Kommission vertritt die Union in internationalen Organisationen.
Europäischer Gerichtshof (EuGH)
Der EuGH ist das Rechtsprechungsorgan der EU, das die Auslegung und Anwendung der Gemeinschaftsverträge sowie des Sekundärrechts sichern soll. Das Gericht hat seinen Sitz in Luxemburg und handelt als überstaatliches Organ frei von den Interessen der Mitgliedstaaten.
Als Europäischer Rat wird das Zusammentreffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten sowie des Präsidenten der Europäischen Kommission bezeichnet. Es ist das höchste Beschlussfassungsorgan der EU und legt die allgemeinen Leitlinien der Politik fest.
Hervorgegangen aus der Gemeinsamen Versammlung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) wurde das Parlament erstmals 1979 in allgemeiner und direkter Wahl gewählt. Im Vertrag von Lissabon (2009) wurde die Anzahl der Sitze auf 751 festgelegt. Nach dem Brexit sinkt die Anzahl der Abgeordneten auf 705. 46 der 73 britischen Sitze werden für mögliche Erweiterungen in Reserve gestellt. 27 Sitze werden auf 14 leicht unterrepräsentierte EU-Länder verteilt. Die Sitzverteilung erfolgt in Fraktionen. In den meisten Fällen übt das Parlament die Gesetzgebungsbefugnis gemeinsam mit dem Rat der EU aus.
Der Europarat ist keine EU-Institution, sondern eine 1949 gegründete intergouvernementale Organisation mit Sitz in Straßburg. Er besteht aus dem Ministerkomitee, der Parlamentarischen Versammlung und dem Kongress der Gemeinden und Regionen Europas. Ziel ist der Schutz der Menschenrechte, die Förderung der kulturellen Vielfalt und die Bekämpfung sozialer Probleme und Fremdenfeindlichkeit.
Der im 18. Jahrhundert im französischen geprägte Begriff der pouvoir executif meint die Ebene und damit Staatsgewalt die sich mit dem Vollzug und der Umsetzung von Gesetzen befasst. Das sind Regierung und Verwaltung.
Die staatliche Aufsicht kann bei der Erfüllung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises über die Rechtskontrolle hinaus auch fachliche Weisungen erteilen.
Fachbezogene und fachübergreifende Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur Bewältigung der gestellten Anforderungen erforderlich sind.
Geregelt in § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB. In der Festlegungssatzung kann die Gemeinde bebaute Bereiche im Außenbereich als im Zusammenhang bebaute Ortsteile festlegen, wenn diese Flächen im Flächennutzungsplan als Bauflächen dargestellt sind. Bebaute Bereiche sind Bebauungszusammenhänge, denen die Ortsteileigenschaft – noch – fehlt. Die Festlegungssatzung ersetzt diese Ortsteileigenschaft. Aus der vormaligen Splittersiedlung im Außenbereich wird ein im Zusammenhang bebauter Ortsteil im Sinn des § 34 BauGB. Ein Hinausgreifen in den Außenbereich aus dem Bebauungszusammenhang hinaus ist aber mit der Festlegungssatzung nicht möglich. Dazu bedürfte es einer Einbeziehungssatzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB.
Der Begriff Finanzausgleich ist ein Oberbegriff. Er umfasst den bundesstaatlichen Finanzausgleich (Bund/Länder), den Länderfinanzausgleich und den kommunalen Finanzausgleich. Der kommunale Finanzausgleich mit 9,97 Mrd. € in 2019 in Bayern (BW: 10 Mrd. €, NRW: 12 Mrd. €) hat das Ziel durch Zuweisungen des Landes die Finanzkraft der Kommunen zu stärken und gleichzeitig vorhandene Steuerkraftunterschiede der Kommunen auszugleichen. Dieser Ausgleich erfolgt in erster Linie über die Schlüsselzuweisungen, Umlagen und die Investitionsförderung.
Die Finanzhoheit der Kommunen ist wichtiger Bestandteil des Selbstverwaltungsrechts. Sie gibt den Kommunen im Rahmen der Gesetze die Befugnis, die notwendigen Mittel zu beschaffen und über deren Verwendung zu entscheiden. Gemeinden erheben in Ausübung ihrer Finanzhoheit Gebühren, Beiträgeund Steuern.Sie stellen den Haushaltauf und bewirtschaften ihr Vermögen.
Pauschaler Ausgleich der Kosten, die den Gemeinden und Landkreisen bei der Durchführung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises entstehen. Kreisangehörige Gemeinden und Landkreise erhalten in Bayern einen Kopfbetrag von je 18,42 €, kreisfreie Städte 36,84 €. Den Landkreisen wird daneben noch das volle Aufkommen der vom Landratsamt festgesetzten Kosten überlassen. Gemeinden erhalten noch das Aufkommen der von ihnen erhobenen Verwarnungsgelder und Geldbußen. Hinzu kommen Pauschalzuweisungen für verschiedene Aufgaben.
Die Bundesrepublik Deutschland wie auch die EU-Länder verpflichten sich durch den Fiskalvertrag zur Einführung strikter nationaler Schuldenregeln. Damit wird sichergestellt, dass die gesamtstaatliche Haushaltslage ausgeglichen ist oder einen Überschuss aufweist. Der Vertrag sieht vor, dass ab 2014 ein gesamtstaatliches strukturelles Defizit von 0,5 % (bisher 3 %) des nominalen BIP (2018: 3,39 Bill. €) nicht übersteigt, solange die Schuldenquote nicht deutlich unter 60 % liegt. Deutschland kommt seit 2014 ohne Neuverschuldung aus und die Gesamtverschuldung liegt Ende 2019 bei 59 %. Ab 2020 sind auch die Länder und Kommunen an den Fiskalvertrag gebunden!
Geht über ein reines Leerstandsmanagement hinaus und ergänzt es um eine strategische Komponente. Auf Basis einer Standortkonzeption zum weiteren Betriebs- und Branchenmix werden über den Aufbau einer Datenbank Maßnahmen für sinnvolle Übergangs- bzw. Zwischennutzungen sowie im optimalen Fall eine erfolgreiche Vermarktung in die Wege geleitet. Der Aufbau und die Pflege von Kontakten zu Immobilieneigentümern, kommunalen Interessengruppen, möglichen Investoren und Expansionsabteilungen bilden einen Schwerpunkt in diesem Aufgabenfeld.
Geregelt in §§ 1 Abs. 2, 5 ff. BauGB. Der Flächennutzungsplan ist der vorbereitende Bauleitplan in der Gemeinde. Er stellt für das ganze Gemeindegebiet die sich aus der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennutzung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Gemeinde in den Grundzügen dar. Als Gemeindeinternum wirkt er nicht baurechtssetzend nach außen. Wenn die Gemeinde Bebauungspläne aufstellt, muss sie diese allerdings aus dem Flächennutzungsplan entwickeln.
Читать дальше