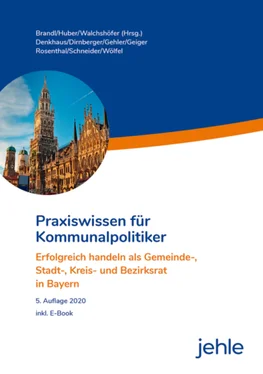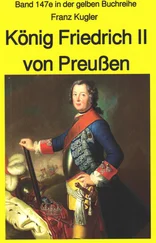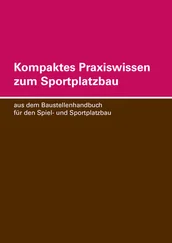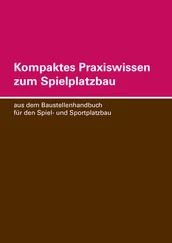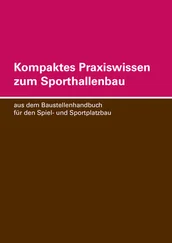Disziplinargewalt ist das Recht des Disziplinarvorgesetzten, Ahndungsmaßnahmen gegen Beamte auf der Grundlage des Disziplinarrechts zu verhängen.
Dokumentenmanagementsystem (DMS)
Ein DMS ist ein System zur Verwaltung und Archivierung von elektronischen Dokumenten. Dokumentenmanagementsysteme kommen im Rahmen der elektronischen Aktenführung zum Einsatz und ermöglichen z. B. die Versionierung von Dokumenten.
Geregelt in § 5 BauNVO. Das Dorfgebiet (MD) ist ein Baugebietstyp der BauNVO, der als Art der baulichen Nutzung in einem Bebauungsplan festgesetzt werden kann. Dorfgebiete dienen der Unterbringung der Wirtschaftsstellen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, dem Wohnen und der Unterbringung von nicht wesentlich störenden Gewerbebetrieben sowie der Versorgung der Bewohner des Gebiets dienenden Handwerksbetrieben. Die Festsetzung eines so strukturierten Dorfgebiets „auf der grünen Wiese“ dürfte kaum denkbar sein. Ein Dorfgebiet sollte nur dann festgesetzt werden, wenn – ggf. unter Einbeziehung bereits vorhandener landwirtschaftlicher Betriebe innerhalb des Geltungsbereichs – eine echte Durchmischung der in der Zweckbestimmung genannten Nutzungen erfolgt.
Die doppelte kommunale Buchführung – Doppik – arbeitet mit dem Finanzhaushalt, dem Ergebnishaushalt und der Bilanz. Rechtsgrundlage ist Art. 61 Abs. 4 GO und die Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, Landkreise und Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung (KommHV-Doppik). Die Doppik ordnet die Erträge und Aufwendungen (einschl. Abschreibungen und Rechnungsabgrenzungen) dem Ergebnishaushalt zu. Dieser ist das Planungsinstrument des doppischen Haushaltsrechts. Der Finanzhaushalt beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die Veränderung des Geldvermögens dar. Die Bilanz enthält die Darstellung von Vermögen und Schulden und wird nur im Jahresabschluss als Ist-Rechnung geführt.
Zielgerichteter Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien zur Erfüllung von Verwaltungsaufgaben.
Der E-Government-Pakt regelt seit 2002 die Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Bayern und den Kommunalen Spitzenverbänden im Bereich des E-Government.
Gesetze zur Förderung der elektronischen Verwaltung auf Bundes- und Landesebene. Ziel ist es, Hindernisse für durchgängig elektronisches Verwalten zu beseitigen und Anreize für die Bereitstellung und Nutzung von elektronischen Behördendiensten zu schaffen.
Plattform zur Bündelung von Online-Verwaltungsleistungen, die neben antragsbezogenen Informationen auch Transaktionen (z.B. Antragstellung, E-Payment von Gebühren, Bekanntgabe Bescheid) ermöglicht.
Ehrenamtliches Engagement
Ehrenamtliche Tätigkeit und ehrenamtliches (bürgerschaftliches) Engagement: Zu unterscheiden ist zwischen dem Ehrenamt, zu dem die Kommunal(wahl)gesetze verpflichten (z. B. Mitglied eines kommunalen Organs oder eines Wahlvorstandes), und der freiwilligen ehrenamtlichen Mitarbeit z. B. im sozialen oder kulturellen Bereich.
Eigenbetriebe sind kommunale Unternehmen, die außerhalb der allgemeinen Kommunalverwaltung als organisatorisch selbständige Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt werden. Sie sind als Sondervermögen weitgehend haushaltsrechtlich verselbständigt. Der Eigenbetrieb wird durch eigenständige Organe (Werkleitung, Werkausschuss) verwaltet.
Die Kommunen als ursprüngliche Gebietskörperschaften erfüllen eigene und übertragene Aufgaben. Im eigenen Wirkungskreis sind das die Aufgaben, die unmittelbar dem Selbstverwaltungskern der der Kommunen entspringen, wie Feuerschutz, Erwachsenenbildung, Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, Licht und Elektrizität. Vgl. Art. 83, Art. 11 II BV; Art. 7 BayGO. Natürlich sind die Kommunen dabei an Gesetz und Recht gebunden, verfügen aber über Ermessensspielräume, und unterliegen „nur“ der Rechtsaufsicht. Vgl. Art. 109 BayGO.
Eigengesellschaft sind kommunale Unternehmen, die in Rechtsformen des Privatrechts betrieben werden und bei denen die Kommune alle Anteile hält.
Geregelt in § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB. Mit der Einbeziehungssatzung kann die Gemeinde einzelne Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile einbeziehen, wenn die einbezogenen Flächen durch die bauliche Nutzung des angrenzenden Bereichs geprägt sind. Damit ist die baurechtsbegründende Aufnahme einer Außenbereichsfläche in den Innenbereich möglich.
Geregelt in § 30 Abs. 3 BauGB. Einem einfachen Bebauungsplan fehlt mindestens eine Festsetzung des § 30 Abs. 1 BauGB. Das bedeutet, dass der einfache Bebauungsplan für sich allein kein Baurecht im planungsrechtlichen Sinn enthält, sondern dass dort, wo er nicht regelt auf § 34 BauGB oder auf § 35 BauGB zurückgegriffen werden muss. Bedeutung hat der einfache Bebauungsplan vor allem in im Zusammenhang bebauten Ortsteilen, bei denen die Gemeinde nur einen ganz bestimmten Bereich regeln – z. B. die Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden begrenzen – will.
Geregelt in § 34 Abs. 1 BauGB. Das Einfügungsgebot ist das zentrale Instrument zur Beurteilung der planungsrechtlichen Zulässigkeit von Vorhaben im Innenbereich. Vorhaben müssen sich dabei nach der Art und dem Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen. Weitere Kriterien, die in § 34 Abs. 1 BauGB nicht genannt werden, etwa die Zahl der Wohnungen, können nicht herangezogen werden.
Ein Einheimischenmodell dient insbesondere der Versorgung der ansässigen Bevölkerung mit Wohnraum. Zum Teil wird mit Einheimischenmodellen nach bestimmten Auswahlkriterien, z. B. Einkommen, Familienstand etc. Ortsansässigen beim Kauf von Bauland nicht nur Vorrang eingeräumt, sondern sogar ein wirtschaftlicher Vorteil. Einheimischenmodelle dienen insbesondere der Sicherung und Stabilisierung der Baulandpreissteigerung.
Das Einheimischenmodell ist eine besondere Form des städtebaulichen Vertrags. Dabei werden Vereinbarungen zwischen dem Grundstückseigentümer und der Gemeinde geschlossen, die sicherstellen sollen, dass bei der Bebauung neuer Wohnbauflächen Ortsansässige bevorzugt zum Zug kommen. Man unterscheidet sog. Zwischenerwerbsmodelle, bei denen die Gemeinde Flächen ankauft, um sie nach Überplanung vergünstigt an Einheimische weiter zu veräußern, und sog. Vertragsmodelle, bei denen sich der ursprüngliche Grundstückseigentümer gegenüber der Gemeinde dazu verpflichtet. Im Einzelnen sind die konkreten Vertragsausgestaltungen sehr unterschiedlich.
Im Rahmen eines Vertragsverletzungsverfahrens der EU wurde festgelegt, dass eine Veräußerung unter Verkehrswert nur an bedürftige Ortsansässige erfolgen darf, die bestimmte Einkommens- und Vermögenshöchstgrenzen nicht überschreiten.
Die Einkommensteuer (einschl. Lohn- und Kapitalertragsteuer sowie Zinsabschlagsteuer) ist die wichtigste Einnahmequelle der öffentlichen Haushalte. Die Gemeinden sind am örtlichen Aufkommen mit 15 % beteiligt. 2018 betrug der Anteil der Gemeinden in Bayern 8.262 Mio. €.
Читать дальше