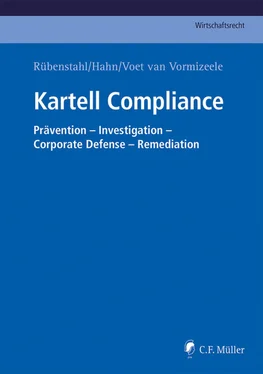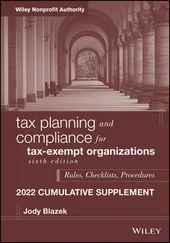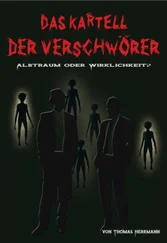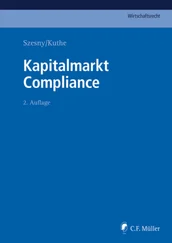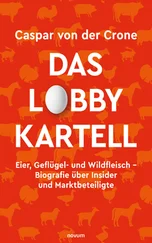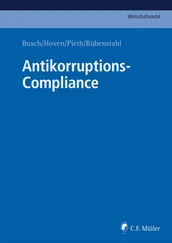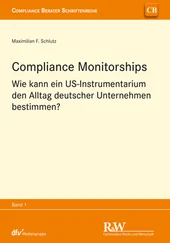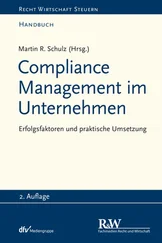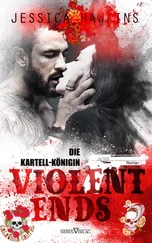V. Verhältnis zur nationalen Fusionskontrolle
58
Für alle Zusammenschlüsse von gemeinschaftsweiter Bedeutung gilt der Grundsatz der ausschließlichen Zuständigkeit der Kommission (Art. 21 Abs. 3 FKVO). Nach diesem sog. „one stop shop“-Prinzipist eine gleichzeitige, parallele Fusionskontrolle durch die Kartellbehörden der Mitgliedstaaten ausgeschlossen. Diese dürfen daher weder von der Kommission genehmigte Zusammenschlüsse untersagen noch von der Kommission untersagte Zusammenschlüsse nachträglich genehmigen. Es gibt jedoch einige Durchbrechungen dieses Ausschließlichkeitsprinzips. Zum einen kann die Kommission einen Zusammenschluss ganz oder teilweise an die Kartellbehörde eines Mitgliedstaates verweisen, sofern hierdurch der Wettbewerb auf einem Markt in diesem Mitgliedstaat, der die Merkmale eines gesonderten Marktes aufweist, erheblich beeinträchtigt würde und der Mitgliedstaat die Verweisung beantragt hat (Art. 9 Abs. 2 FKVO). Darüber hinaus sieht die FKVO auch die Möglichkeit einer „umgekehrten“ Verweisung von den Mitgliedstaaten an die Kommissionvor. Nach Art. 22 FKVO kann ein Zusammenschluss, dem keine gemeinschaftsweite Bedeutung zukommt, auf Antrag eines Mitgliedstaates oder mehrerer im Einvernehmen handelnder Mitgliedstaaten von der Kommission nach den Regeln der FKVO beurteilt werden.[82]
59
Die Verweisung eines Zusammenschlusses kann auch auf Veranlassung der beteiligten Unternehmen erfolgen. Bereits vor Einreichung einer Anmeldung können die Unternehmen bei der Kommission den Antrag stellen, einen Zusammenschluss von gemeinschaftsweiter Bedeutung an einen oder mehrere Mitgliedstaaten zu verweisen (Art. 4 Abs. 4 FKVO). Voraussetzung hierfür ist, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb in einem Markt in einem Mitgliedstaat, der alle Merkmale eines gesonderten Marktes aufweist, erheblich beeinträchtigen könnte. Umgekehrt können die beteiligten Unternehmen eines Zusammenschlusses, der keine gemeinschaftsweite Bedeutung hat aber nach dem Wettbewerbsrecht von mindestens drei Mitgliedstaaten geprüft werden könnte, den Antrag stellen, dass der Zusammenschluss von der Kommission geprüft werden sollte (Art. 4 Abs. 5 FKVO).
C. Deutsche Fusionskontrolle
60
Findet die europäische Fusionskontrolle auf einen Unternehmens- oder Beteiligungskauf keine Anwendung, entweder weil die Umsatzschwellen der FKVO nicht erreicht werden oder kein Zusammenschlusstatbestand verwirklicht wird, so sind mögliche Anmeldepflichten in den einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu prüfen. Der deutschen Fusionskontrolle kommt dabei eine besondere Relevanz zu, da sie aufgrund der im internationalen Vergleich niedrigen Umsatzschwellen und des sehr weit gefassten Zusammenschlussbegriffs auf viele Transaktionen Anwendung findet.
61
Die im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) enthaltenen Vorschriften der deutschen Fusionskontrolle wurden zuletzt durch die 9. GWB-Novelle mit Wirkung ab dem 9.6.2017 geändert. Die wesentliche Änderung betrifft die Einführung einer weiteren Aufgreifschwelle für die deutsche Fusionskontrolle, die nicht allein auf die Umsatzerlöse der beteiligten Unternehmen, sondern vor allem auf den Wert der Transaktion abstellt.
I. Zusammenschlusstatbestand
62
Der Zusammenschlussbegriff der deutschen Fusionskontrolle ist abschließend in § 37 GWB geregelt. Die einzelnen Zusammenschlusstatbestände schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern sind nebeneinander anwendbar mit der Folge, dass häufig mehrere Tatbestände des Abs. 1 gleichzeitig erfüllt sind. Auch in diesen Fällen liegt jedoch nur ein Zusammenschluss im Rechtssinne vor.[83]
63
Nach § 37 Abs. 1 Nr. 1 GWB liegt ein Zusammenschluss vor, wenn ein Unternehmen das Vermögen eines anderen Unternehmens ganz oder zu einem wesentlichen Teil erwirbt. Für den Erwerbstatbestand ist der Rechtsgrund ohne Belang. Er kann auf privatrechtlichem Rechtsgeschäft, auf staatlichem Hoheitsakt oder Gesetz beruhen, in der Zwangsvollstreckung oder von Todes wegen erfolgen. Der Begriff des Vermögens eines Unternehmens ist in Übereinstimmung mit den allgemeinen handels- und bilanzrechtlichen Regelungen zu bestimmen und erfasst alle seine geldwerten Güter und Rechte, sofern sie verkehrsfähig sind. Erwerbsgegenstand können daher alle geldwerten, unternehmerisch genutzten Vermögensgegenstände eines Unternehmens sein, wie z.B. Produktionsstätten, eingeführte Warenzeichen, der Kundenstamm, Forderungen, der Goodwill, Know-how bzw. Betriebsgeheimnisse und die Absatzorganisation.[84] Die Beschränkung auf Vermögensgegenstände schließt die Passiva als Teil des Vermögens aus.
Ein Vermögenserwerb liegt einerseits dann vor, wenn der Käufer das gesamte Vermögen eines anderen Unternehmens erwirbt, sei es durch Kauf- und Übertragungsvertrag (asset deal) oder im Wege der Umwandlung oder Verschmelzung. Werden dagegen nur Teile des Betriebsvermögens aus einer größeren Unternehmenseinheit erworben, so kommt es darauf an, ob es sich hierbei um den wesentlichen Teil des Unternehmensvermögenshandelt. Dies ist dann der Fall, wenn es sich um einen abgrenzbaren Vermögensteil handelt, der für die Stellung des Veräußerers auf dem Markt kennzeichnend war und dessen Erwerb abstrakt geeignet ist, die Stellung des Erwerbers auf dem Markt zu verändern.[85] Darunter können nach den Umständen des Einzelfalles etwa auch einzelne Einzelhandelsfilialen, Zementwerke und Titel- und Herausgaberechte für Zeitschrift fallen.[86]
64
Der zum Zwecke einer weiteren Harmonisierung mit dem europäischen Kartellrecht eingeführte Zusammenschlusstatbestand des Kontrollerwerbs in § 37 Abs. 1 Nr. 2 GWB folgt weitgehend der Regelung in Art. 3 Abs. 1 FKVO.[87] Erfasst wird daher auch im deutschen Recht der Erwerb der unmittelbaren oder mittelbaren Kontrolle durch ein oder mehrere Unternehmen über die Gesamtheit oder Teile eines oder mehrerer Unternehmen. Die Kontrolle kann dabei durch Rechte, Verträge oder andere Mittel begründet werden, die einzeln oder zusammen unter Berücksichtigung aller tatsächlichen oder rechtlichen Umstände (dem Erwerber) die Möglichkeit gewähren, einen bestimmenden Einfluss auf die Tätigkeit eines Unternehmens auszuüben. Entscheidend ist somit, dass der Erwerber rechtlich oder tatsächlich die wesentlichen Entscheidungen des Zielunternehmens inhaltlich beeinflussen kann.
Der wichtigste Fall des Kontrollerwerbs ist der Erwerb von mehr als 50 % des stimmberechtigten Kapitals, der i.d.R. die Alleinkontrolleüber das Unternehmen vermittelt, da der Erwerber die Möglichkeit erlangt die Zusammensetzung der Organe zu beeinflussen. Alleinige Kontrolle kann aber auch bei einer Beteiligung von deutlich unter 50 % gegeben sein, z.B. wenn der Erwerber dauerhaft die faktische Mehrheit Hauptversammlung hat, weil sich die übrigen Gesellschaftsanteile in Streubesitz befinden oder aufgrund vertraglich eingeräumter Vetorechte.
65
Eine gemeinsame Kontrolledes Zielunternehmens besteht zum einen dann, wenn die Gesellschafter, die gemeinsam die Mehrheit der Stimmrechte des Zielunternehmens halten, die gemeinsame Leitung des Unternehmens vereinbaren (z.B. in einem Stimmbindungs- oder Poolvertrag). Sie ist auch im Falle einer 50:50-Beteiligung gegeben, wenn aufgrund gegenseitiger Blockademöglichkeiten ein faktischer Einigungszwang zwischen den Gesellschaftern besteht. Gemeinsame Kontrolle liegt schließlich aber auch dann vor, wenn der Erwerber nur eine Minderheitsbeteiligung erwirbt, jedoch in wesentlichen Angelegenheiten des Zielunternehmens (z.B. Verabschiedung des jährlichen Geschäftsplans, Bestellung der Geschäftsführung) Vetorechte erhält. Entsprechendes gilt für den umgekehrten Fall (der Erwerber erwirbt die Mehrheit, räumte aber dem Minderheitsgesellschafter solche Vetorechte ein). Keine Kontrolle liegt im Regelfall vor, wenn der Erwerber lediglich eine Minderheitsbeteiligung erwirbt und keine über den gesetzlichen Minderheitenschutz bei sog. Grundlagenentscheidungen (z.B. Satzungsänderungen) hinausgehenden Rechte bzw. Einflussmöglichkeiten erhält.
Читать дальше