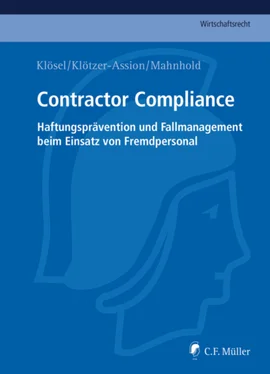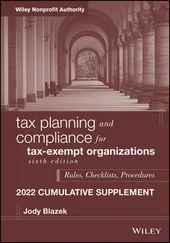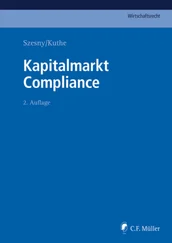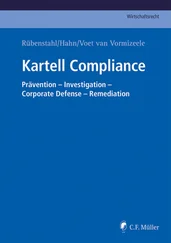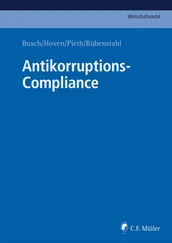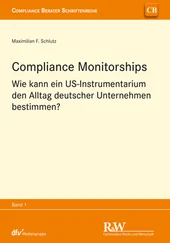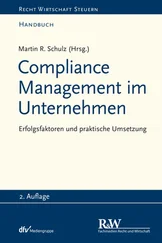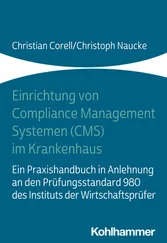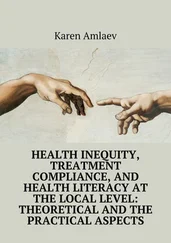10
Diese erfassen zunächst sog. Solo-Selbstständige, die auf Grundlage eines Werk- oder Dienstvertrags entweder als natürliche Person oder – in letzter Zeit häufig zu beobachten – über eine sog. „ Ein-Mann-GmbH“ tätig werden. Letzteres bezeichnet den Fall, das der Auftragnehmer zwar eine juristische Person etwa in Form einer GmbH darstellt, die allerdings lediglich aus einer einzigen natürlichen Person als deren Alleingesellschafter und Geschäftsführer besteht und die auch über keine weiteren Mitarbeiter verfügt.[1]
11
Die Anzahl der Solo-Selbstständigen ist in Deutschland in der jüngeren Vergangenheit sehr stark gestiegen. Betrug die Zahl im Jahr 2000 noch ca. 1,75 Mio. und entsprach damit in etwa der Anzahl von Selbstständigen mit Beschäftigten, erhöhte sich die Zahl der Solo-Selbstständigen in den darauf folgenden Jahren der politisch geförderten „Ich-AG“ bis 2012 um etwa 43 % auf ca. 2,5 Mio., während die Anzahl der Selbstständigen mit Beschäftigten nahezu gleich blieb. Bis heute stellt der Personenkreis der Solo-Selbstständigen mit nahezu 60 % die Mehrheit der Selbstständigen. Im europäischen Vergleich liegt diese Quote allerdings nahezu 15 % unter EU-Durchschnitt, wobei Deutschland mit diesem verhältnismäßig niedrigen Anteil Solo-Selbstständiger sogar den viertletzten Platz belegt.[2]
12
Mit Blick auf die Berufsstruktur der Solo-Selbstständigen in Deutschland fällt eine weitere Besonderheit im europäischen Vergleich auf, denn in keinem anderen Land gehen eine derart hohe Zahl von über 70 % der Solo-Selbstständigen einer wissenschaftlichen bzw. akademischen, technischen oder gleichrangigen nicht technischen Tätigkeit nach. Dies spiegelt sich auch in der Qualifikationsstruktur wider: Nirgendwo in Europa – abgesehen von Belgien – ist der Anteil Solo-Selbstständiger mit einer akademischen Ausbildung von 44 % so hoch wie in Deutschland. Nur ein weit unterdurchschnittlicher Teil von 7 % verfügt über keine Berufsausbildung.[3]
13
Dieser empirische Befund deckt sich auch mit den praktischen Erfahrungen bei Statusfragen in Bezug auf Solo-Selbstständige. Derartige Verfahren betreffen in vielen Fällen etwa IT-Spezialisten, Entwickler, Ingenieure oder wissenschaftliche Fachkräfte, die jeweils über ein sehr hoch spezialisiertes Fachwissen verfügen, das in dieser Form nicht intern beim Auftraggeber abrufbar ist.[4] Auch in diesen Fällen können mit Blick auf die Statusfeststellung aber wesentliche Unterschiede bestehen, da auch diese hochspezialisierten Tätigkeitenin einzelnen Fällen entweder als Projektarbeit nach freier zeitlicher Einteilung und ortsungebunden von „zu Hause aus“ erledigt werden können, in anderen Fällen aber eine Einbindung in größere Projektteams mit regulären Arbeitnehmern auf dem Betriebsgelände des Auftraggeber-Unternehmens und/oder die umfassende Nutzung von wesentlichen Betriebsmitteln erforderlich sein kann. Während die zuerst genannten Fälle unter Gesichtspunkten einer (Schein-)Selbstständigen-Compliance in der Regel keinen großen Aufwand erfordern, gestaltet sich in den zuletzt genannten Fällen eine rechtssichere Ausgestaltung einer selbstständigen Tätigkeit dagegen oftmals äußerst problematisch.[5] In der Praxis scheidet deshalb schon bei hochspezialisierten Fachkräften eine verallgemeinerbare Statusbeurteilung nach einheitlichen Kriterien aus.
14
Dies gilt erst recht für eine Statusbeurteilung bei weniger fachspezialisierten Solo-Selbstständigen. Denn mit Blick auf die genannten Zahlen und den praktischen Erfahrungen aus der jüngeren Vergangenheit greifen Unternehmen nicht allein auf hochspezialisierte Freelancer zurück. Diese üben in vielen Fällen auch weniger spezialisierte Tätigkeitenaus, wie etwa im Bau-, Sicherheits-, Reinigungs- und Pflegegewerbe oder bei Montierern, Bürokräften oder Technikern.[6] In diesen Fällen kommt über die bereits hinsichtlich der hochspezialisierten Solo-Selbstständigen genannten Probleme der weitere Aspekt dazu, dass weniger spezialisierte Tätigkeiten oftmals auch eine effektive Fachaufsicht durch den Auftraggeber bzw. dessen Mitarbeiter erfordern, was ein zusätzliches gewichtiges Indiz für eine Scheinselbstständigkeit bilden kann.[7]
15
In compliance-relevanter Hinsicht ist eine verallgemeinerbare Statusfeststellung nach einheitlichen Maßstäben jedenfalls nicht möglich. Aufgrund der Vielzahl von Beschäftigungsformen und ihren jeweils konkreten Ausgestaltungen nicht nur innerhalb der Gruppe der Solo-Selbstständigen, sondern auch der möglichen Tätigkeitsfelder bleibt ein jeweils einzelfallabhängiger Zuschnitt der jeweiligen compliance-relevanten Maßnahmen unabdingbar.
b) Outsourcing/Werkvertragsunternehmer
16
Die Beschäftigungsformen an der Grenze zu einer vermeintlichen Scheinselbstständigkeit erfassen darüber hinaus auch zahlreiche Fälle, in denen der Auftragnehmer als juristische Person einen Werk- oder Dienstvertragmit dem Auftraggeber-Unternehmen abschließt und zur Erfüllung dieser vertraglichen Verbindlichkeiten eigene Mitarbeiter einsetzt, die dann beim Auftraggeber-Unternehmen tätig werden.
17
In Deutschland belief sich die Anzahl von Selbstständigen mit eigenen Beschäftigten zuletzt auf etwa 1,75 Mio. Personen bzw. Unternehmen. Im Gegensatz zum Fall der Solo-Selbstständigen bestehen allerdings keine verlässlichen empirischen Werte zu den Entwicklungen in den letzten Jahren. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages hatte einen entsprechenden Antrag zur statistischen Erhebung von Leiharbeit und Werkverträgen im Jahr 2013 abgelehnt.[8] Aktuellen Branchenschätzungen zufolge sollen aber beispielsweise allein in der Metall- und Elektroindustrie bereits fast ein Drittel aller Mitarbeiter, d.h. insgesamt über eine Million Beschäftigte, als Externe über Werk- und Zeitarbeitsverträge tätig sein.[9]
18
Vor diesem Hintergrund weisen vor allem gewerkschaftsnahe Kreise auf eine Entwicklung hin, wonach seit einigen Jahren, spätestens im Zuge der „Regulierung der Leiharbeit“ vor allem durch die Rechtsprechung des BAG,[10] dieses frühere zur Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen eingesetzte Gestaltungsmittel zunehmend durch „neue Werkverträge“ersetzt wird. Im Gegensatz zu dem bekannten Vorgehen, bei dem Auftraggeber von einem Werkunternehmer lediglich Produkte und Leistungen einkaufen, die nur gelegentlich benötigt werden und deren Erstellung nicht zum Kernkompetenzbereich des Unternehmens zählen, zeichnen sich diese „neuen Werkverträge“ vor allem durch drei Merkmale aus:
| 1. |
die Werkverträge werden zunehmend auf Dauer und nicht nur gelegentlich geschlossen, |
| 2. |
es werden Werke, Produkte oder Leistungen eingekauft, die bisher zum Kernbereich der eigenen Produktion gehörten und durch eigene Arbeitnehmer verrichtet wurden, |
| 3. |
die Produkte oder Leistungen werden von den beauftragten Fremdunternehmen auf dem Betriebsgelände und an Arbeitsplätzen und Maschinen des beauftragenden Unternehmens erstellt (sog. „Onsite-Werkverträge“). Alle drei Merkmale machen diese Form „neuer Werkverträge“ in compliance-relevanter Hinsicht höchst brisant.[11] |
19
Unabhängig davon wird aber übereinstimmend davon ausgegangen, dass es neben derartigen – zum Teil auch politisch zu missbilligenden – Konstellationen eine weit überwiegende Anzahl eines „alten Typus“politisch völlig unverdächtiger Werkunternehmer gibt, die branchenübergreifend einer Vielzahl von Auftraggebern hochspezialisierte Leistungen anbieten, die nicht zu deren jeweiligen Kernkompetenzfeld gehören. Beispiele hierfür sind die Erstellung der zahlreichen abgrenzbaren Gewerke beim Bau von Gebäuden oder Industrieanlagen oder die Entwicklung bestimmter IT-Produkte, hochspezialisierter Test- oder Fertigungsverfahren oder sonstiger Bauteile. Derartige Spezialisierungen innerhalb von Produktionsprozessen waren zu jeder Zeit unabdingbare Voraussetzung einer arbeitsteiligen Marktwirtschaft. In compliance-relevanter Hinsicht sind diese Fälle deshalb auch in aller Regel zu vernachlässigen.[12]
Читать дальше