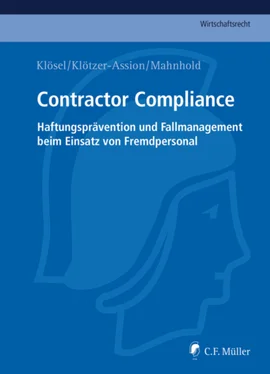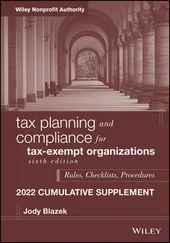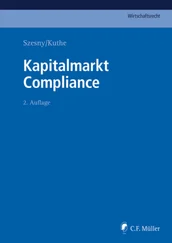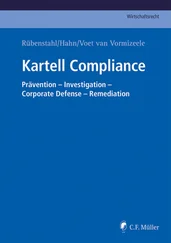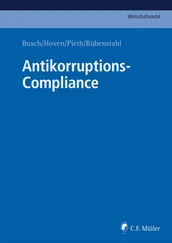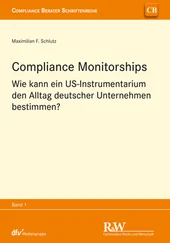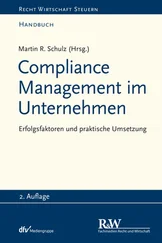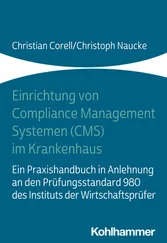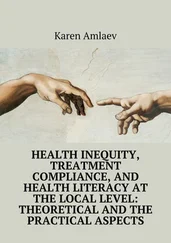I. Straf- und bußgeldrechtliche Verantwortung der Geschäftsleitung – Grundsätze
II. Strafbares Vorenthalten von Sozialversicherungsbeiträgen, § 266a StGB
1. § 266a Abs. 1 StGB
2. § 266a Abs. 2 StGB
a) § 266a Abs. 2 Nr. 1 StGB
b) § 266a Abs. 2 Nr. 2 StGB
3. Zusammentreffen von § 266a Abs. 1 und Abs. 2 StGB
4.§ 266a StGB als Vorsatzdelikt
a) Grundsatz
b) Rechtsprechung des 1. Strafsenats des BGH zu den Anforderungen an die subjektive Tatseite
c)Beachtliche Gegenansichten der Tat- und Zivilgerichte
aa) LG Ravensburg, Urteil vom 26.9.2006
bb) LG Karlsruhe, Urteil vom 27.2.2009
cc) AG Schwetzingen, Urteil vom 6.4.2010
dd) LG Bochum, Urteil vom 28.5.2014
d) Auffassung im Schrifttum
e) Eigene Auffassung
5.Rechtsirrtümer und § 266a StGB
a) Regelungsinhalt des § 17 StGB
b) Behandlung von Irrtümern über die Arbeitgebereigenschaft durch den 1. Strafsenat des BGH
c) Einwände
6.Rechtsfolgen des § 266a StGB
a) Strafandrohung bei Verwirklichung des Grunddelikts
b) Strafverschärfung bei Vorliegen eines besonders schweren Falles
7. Absehen von Strafe und Strafaufhebung, § 266a Abs. 6 StGB
8. Verfolgungsverjährung
9.Exkurs: Gesetzeskonkurrenz zwischen § 266a StGB und § 263 StGB
a) § 266a StGB als lex specialis
b) Strafbarkeit nach § 263 StGB
III.Lohnsteuerhinterziehung nach § 370 AO
1. Tatbestandsvoraussetzungen des § 370 AO
2. Tathandlungen und Taterfolg bei der Lohnsteuerverkürzung
3. Subjektiver Tatbestand
4.Rechtsfolgen
a) Verwirklichung des Grunddelikts
b) Strafschärfung im besonders schweren Fall
c) Ergebnis
5. Versuchsstrafbarkeit
IV. Umsatzsteuerverkürzung gem. § 370 AO
V. Zwischenergebnis zu den strafrechtlichen Konsequenzen
VI.Bußgeld- und außerstrafrechtliche Konsequenzen der Statusverfehlung
1. Vorbemerkung
2.Ausgewählte Ordnungswidrigkeiten
a) § 111 SGB IV
b) § 23 AEntG
c) § 21 MiLoG
d) § 16 AÜG
e) Sanktionsmöglichkeiten in Fallgestaltungen mit (EU) Ausländern
f) Aufsichtspflichtverletzung, § 130 OWiG
g) Verbandsbuße, § 30 OWiG
VII.Eintragungen rechtskräftiger Strafen und Bußen, Vergabesperren
1. Gewerbezentralregister
2. Ausschluss von öffentlichen Aufträgen, black list
3. Landes-Korruptionsregister
4. Bundeszentralregister
VIII. Vermögensabschöpfungsmaßnahmen
5. Kapitel Zivilrechtliche Konsequenzen für Organe
I. Ausgangspunkt
II. Haftungssubjekt „Organ“
III. Außenhaftung
1. Anspruch der Einzugsstelle nach § 823 Abs. 2 BGB i.V.m. § 266a StGB
2. Anspruch der Finanzverwaltung nach § 69 AO
IV. Innenhaftung
1.Die Pflichtenstellung
a) Geschäftsführer und Vorstand
aa)Objektive Pflichtwidrigkeit
(1) Organisationsermessen/Business Judgement Rule
(2) Weisung oder Einverständnis der Gesellschafter/Hauptversammlung
bb) Subjektive Pflichtwidrigkeit – Verschulden
cc) Kausalität/Zurechnung – Rechtmäßiges Alternativverhalten
b) Aufsichtsrat
c) Vertragliche Haftung
2. Entlastungsbeschluss der Gesellschafter/Hauptversammlung
3. Compliance-Pflicht im Konzern
4. Ersatzfähiger Schaden und Kausalität
a) Sozialversicherungsbeiträge und Säumniszuschläge
b) Verbandsgeldbuße
c) Aufklärungskosten, Kosten einer internal investigation
d) Lohnsteuer
5. Darlegungs- und Beweislastverteilung
6. Verjährung
V. Versicherbarkeit von Haftungsrisiken: D&O-Versicherung
VI. Ehrenamtliche Leitungsorgane
VII. Besondere Insolvenzverschleppungsrisiken, § 15a InsO
5. Teil Strategien zur Haftungsvermeidung
1. Kapitel Compliance
I. Grundlage der (Schein-) Selbstständigen-Compliance in der Contractor Compliance
II. Motive zur Implementierung einer (Schein-) Selbstständigen-Compliance
1. Unternehmensimage
2. Haftungsprävention
a) Vermeidung von Problemfällen
b) Vermeidung von Geldbußen etc
c) Haftungsprävention durch Wissensmanagement
III. Struktur einer (Schein-) Selbstständigen-Compliance
1. Einführung einer (Schein-) Selbstständigen-Compliance
a) Risikoanalyse
b) Integration der (Schein-) Selbstständigen-Compliance in Compliance-Strukturen
2. Elemente eines Compliance-Konzepts
a) Maßnahmen „nach innen“ ins eigene Unternehmen
aa) Aufklärung von Zielgruppen im Unternehmen
(1) Leitlinien/Verpflichtungserklärungen
(2) Schulungen
bb) Beratungsmöglichkeiten
cc) Hinweisgebersysteme
dd) Monitoring
ee) Behandlung von Problemfällen
b) Maßnahmen „nach außen“ gegenüber Vertragspartner
aa) „Contractor Due Diligence“
bb) Vertragsmanagement
(1) Vertragliche Informations- und Dokumentationspflichten
(2) Freistellungserklärungen
(3) Beschränkung der Nachunternehmerkette
(4) Auditierungsrechte
(5) Sonderkündigungsrechte
3. Organisation des Fremdpersonaleinsatzes und Vertragsgestaltungen als Element der Haftungsprävention
a) Kontaktsteuerung/Repräsentantenmodelle
aa) Zwischenschaltung von Disponenten etc. – Einfache Repräsentantenmodelle
bb) Ticketsysteme – Institutionalisierte Repräsentantenmodelle
cc) Räumliche Abgrenzung
b) Durchprogrammierung des Arbeitsprozesses im Vertrag
c) Gründung von „Ein-Mann GmbH“
d) Betriebsführungsvertrag
e) Gemeinschaftsbetrieb
f) Personalgestellung und Selbstständigen-Contracting
2. Kapitel Vertragsgestaltung
I. Ausgangspunkt/Bedeutung der Vertragsgestaltung
II. Individuelle Vertragsgestaltung und AGB-Recht
1. Begriff der AGB
2. Einbeziehung
3. Verbot überraschender Klauseln
4. Unklarheitenregel
5. Inhaltskontrolle
6. Einschränkungen des Anwendungsbereichs
7. Rechtsfolgen bei Nichteinbeziehung und Unwirksamkeit
8. Beweislast
III. Die einzelnen Regelungsgegenstände
1.Vertragsgegenstand
a) Allgemeines
b) Rahmenvertrag
2. Vergütung und Abrechnung
3.Verhältnis des Selbstständigen zu Dritten
a) Tätigkeit für andere Auftraggeber
b) Einschaltung Dritter als Erfüllungsgehilfen
4.Geheimhaltung und Datenschutz
a) Geheimhaltung/Verschwiegenheit
b) Datenschutz
5. Aufbewahrung und Rückgabe von Geschäftsunterlagen
6. Nutzung von Betriebsmitteln des Auftraggebers
7. Wettbewerbs- und Abwerbeverbot
8. Vertragsdauer und Kündigung
9. Compliance
10. Sorgfaltsmaßstab und Qualitätskontrolle
11.Gewährleistung und Haftung
a) Gewährleistung
b) Haftung
aa) Haftungsbeschränkung
bb) Haftungserweiterung
cc) Verfallklauseln
dd) Vertragsstrafe/Pauschalierter Schadensersatz
c) Haftpflichtversicherung
12. Rechte an Arbeitsergebnissen
13. Gerichtsstand
14. Rechtswahl
15.Schlussbestimmungen
a) Schriftform
b) Salvatorische Klausel
3. Kapitel Sozialversicherungsrechtliche Möglichkeiten der Haftungsvermeidung
I. Einholung von Rechtsrat
II. Feststellung des sozialversicherungsrechtlichen Status des Auftragsverhältnisses
III.Einfluss der Festsetzungsverjährung auf das Haftungsrisiko
1. Regelverjährung
2. Verjährung bei vorsätzlicher Verletzung von Beitragspflichten
IV.Verteidigung gegen Inanspruchnahme durch den Rentenversicherungsträger
1. Nutzung des Anhörungsverfahrens
2. Ausschließliches Abstellen auf Ermittlungsergebnisse des FKS unzulässig
3. Berechnung des Nacherhebungsbetrages
4. Unverschuldete Unkenntnis von der Zahlungspflicht/Vermeidung von Säumniszuschlägen
Читать дальше