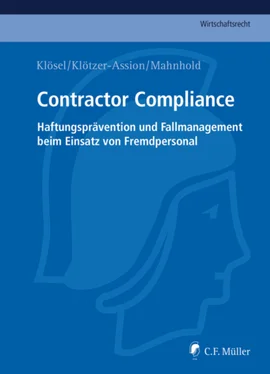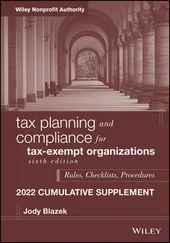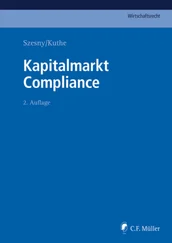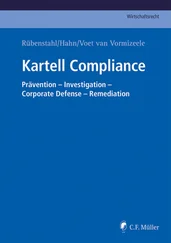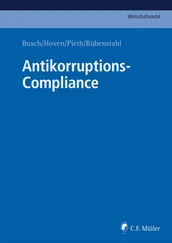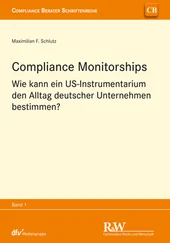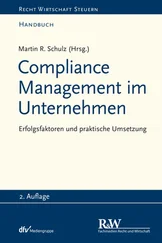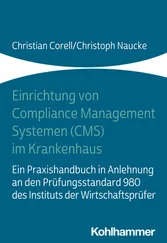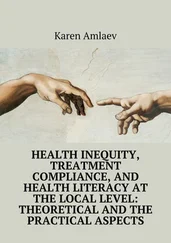5. Kapitel Gemeinsamkeiten und Divergenzen bei der Bestimmung des Arbeitgeberbegriffs
6. Kapitel Besonderheiten beim internationalen/grenzüberschreitenden Sachverhalt
3. Teil Anlass und Möglichkeiten der Feststellung der Arbeitgebereigenschaft
1. Kapitel Beschreitung des Arbeitsrechtswegs
2. Kapitel Sozialversicherungsrechtliche Feststellungmöglichkeiten
3. Kapitel Steuerrechtliche Feststellungsmöglichkeiten zur Arbeitgebereigenschaft
4. Kapitel Bindungswirkung behördlicher und/oder gerichtlicher Entscheidungen
4. Teil Konsequenzen der Statusverfehlung
1. Kapitel Arbeitsrechtliche Konsequenzen der Statusverfehlung
2. Kapitel Sozialversicherungsrechtliche Konsequenzen der Statusverfehlung
3. Kapitel Steuerrechtliche Konsequenzen der Statusverfehlung
4. Kapitel Straf- und bußgeldrechtliche sowie außerstrafrechtliche Konsequenzen der Statusverfehlung
5. Kapitel Zivilrechtliche Konsequenzen für Organe
5. Teil Strategien zur Haftungsvermeidung
1. Kapitel Compliance
2. Kapitel Vertragsgestaltung
3. Kapitel Sozialversicherungsrechtliche Möglichkeiten der Haftungsvermeidung
4. Kapitel Steuerrechtliche Möglichkeiten der Haftungseingrenzung
5. Kapitel Strategien zur Vermeidung strafrechtlicher Haftung und/oder der Sanktionierung wegen Ordnungswidrigkeiten
6. Teil Beteiligungsrechte des Betriebsrats
7. Teil Work on Demand – Trends der Arbeitsflexibilisierung
Anhang
Stichwortverzeichnis
Vorwort
Bearbeiterverzeichnis
Inhaltsübersicht
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
1. Teil Problemaufriss: Contractor Compliance
I. Fremdpersonaleinsatz als vernachlässigtes Compliance-Thema
II. Herausforderungen einer Contractor Compliance
1. Vielzahl von Beschäftigungsformen
a) Solo-Selbstständige
b) Outsourcing/Werkvertragsunternehmer
c) Neuartige Fälle: Interim-Management, Scrum, „Work-on-Demand“ etc.
2. Vielzahl „weicher“ Abgrenzungskriterien
a) Vielzahl von Kriterien
b) „Weiche“ Kriterien
c) Variierender Kriterienkatalog
d) Uneinheitliche Rechtsprechungs- und Verwaltungspraxis
3. Vielzahl betroffener Rechtsgebiete
4. Vielzahl erforderlicher Compliance-Maßnahmen
a) Vertrag und/oder gelebte Vertragspraxis?
b) Vertragsmanagement
c) Fallmanagement
d) Sonstige Maßnahmen
5. Vielzahl von weiteren compliance-relevanten Bereichen
a) Regulierung der Haftungsrisiken
b) Regulierung von Eigentums- und Nutzungsrechten
c) Keine Beschränkung auf Statusfragen
III. Eckpfeiler einer Contractor Compliance
2. Teil Der Arbeitgeberbegriff in der deutschen Rechtsordnung
1. Kapitel Definition des arbeitsrechtlichen Arbeitgeberbegriffs
I. Einführung
II. Abgrenzungskriterien
1. Weisungen
a) Inhalt
aa) Vertragliche Definition des Leistungsgegenstandes
bb) Werk- vs. arbeitsvertragliche Weisungen
cc) Eingeschränkte Bedeutung bei „höherwertigen Leistungen“
b) Zeit
c) Ort
2. Betriebliche Eingliederung
a) Ort der Leistungserbringung
b) Zusammenarbeit mit Arbeitnehmern des Einsatzunternehmens
aa) Eigenständige betriebliche Organisation
bb) Weniger problematische Fälle: Betriebsfremde Leistungen, Outsourcing von betrieblichen Nebenleistungen (IT, Werkschutz, Kantine etc.)
cc) Problematische Fälle: Repräsentantenmodelle bei Onsite-Werkverträgen in arbeitsteiligen Prozessen und On-Demand-Werkverträge
c) Einsatz von Betriebsmitteln („Mietmodelle“)
3. Umfang der Tätigkeit
4. Unternehmerrisiko
5. Weitere Kriterien
6. Abweichende Kriterien in Sonderfällen: „Programmgestaltende Rundfunkmitarbeiter“ etc.
III. Tatsächliche Durchführung
IV. Wertende Gesamtbetrachtung
V. Umgehungsmodelle: „Ein-Mann-GmbH“ und Vorratserlaubnis
VI. Fazit
2. Kapitel Definition des sozialversicherungsrechtlichen Arbeitgeberbegriffs
I. Einführung
II. Abgrenzungskriterien: Parallelität und Unterschiede zum Arbeitsrecht
III. Fazit
3. Kapitel Definition des steuerrechtlichen Arbeitgeberbegriffs
I. Einführung
II.Einzelheiten zum steuerrechtlichen Arbeitgeberbegriff
1.Lohnsteuerlicher Arbeitgeberbegriff nach § 1 Abs. 2 LStDV
a) Arbeitgeber und Pflicht zum Lohnsteuereinbehalt
b) Bestimmung des Dienstverhältnisses durch Gesamtschau sämtlicher Indizien
aa) Wertungskriterien
bb) Schulden der Arbeitskraft
cc) Weisungsgebundenheit
dd) Fehlendes Vermögensrisiko – Abgrenzung zur Selbstständigkeit
c) Arbeitgeber und Arbeitnehmer
d) Arbeitslohn und Lohnsteuerabzug
2. Zur Terminologie im Umsatzsteuerrecht
III. Fazit
IV. Einzelfälle zur Abgrenzung der selbstständigen Tätigkeit von einer Tätigkeit als Arbeitnehmer im Steuerrecht
4. Kapitel Definition des strafrechtlichen Arbeitgeberbegriffs
I. Einführung
II. Arbeitgeber im Sinne des § 266a StGB
1. Genuiner Arbeitgeberbegriff in § 266a StGB?
2.Bestimmung des strafrechtlichen Arbeitgeberbegriffs im Schrifttum
a) Auslegung am Maßstab des Sozialversicherungsrechts
b) Rückgriff auf Kriterien nach der Rechtsprechung des BSG
c) Dreipersonenverhältnisse/Arbeitnehmerüberlassung
3.Begriffsprägung durch den BGH in Strafsachen
a) Auslegung nach dem Sozialversicherungsrecht, das seinerseits auf das Dienstvertragsrecht verweist
b) Kriterien
4. Kritik
5. Einfügung einer Arbeitgeber-Definition in das BGB/Auswirkungen diesbezüglicher Initiativen auf die Begriffsbestimmung im Strafrecht
6. Zur Arbeitgeberstellung bei Fremdpersonaleinsatz im Rahmen der europäischen Niederlassungsfreiheit
7. Der faktische Geschäftsführer als Arbeitgeber im Sinne des § 266a StGB
III.Arbeitgeber im steuerstrafrechtlichen Sinne
1. Vorbemerkung
2.Keine Definition des Arbeitgeberbegriffs in § 370 AO
a) Herleitung aus § 1 LStDV
b) Rückgriff auf Kriterien des BFH
3. Begriffsbestimmung durch den BGH in Steuerstrafsachen? – Fehlanzeige
4. Faktische Arbeitgeberstellung nach steuerrechtlichen Kriterien
5. Ergebnis
5. Kapitel Gemeinsamkeiten und Divergenzen bei der Bestimmung des Arbeitgeberbegriffs
I. Gemeinsamkeiten
1. Wesentliche Kriterien im Arbeitsrecht
2. Wesentliche Kriterien im Sozialversicherungsrecht
3. Wesentliche Kriterien im Steuerrecht
4. Wesentliche Kriterien im Strafrecht
II.Divergenzen
1. Schwerpunktsetzung der Arbeitsgerichte und Sozialgerichte
2. Schwerpunktsetzung der Finanzgerichte
3. Schwerpunktsetzung der Strafgerichte
III. Konsequenzen für den Rechtsanwender
IV. Ausblick
6. Kapitel Besonderheiten beim internationalen/grenzüberschreitenden Sachverhalt
I. Einführung
II.Compliance-relevante Fallkonstellationen
1.Solo-Selbstständige (Zweipersonenverhältnis)
a)Inbound
b)Outbound
2.Werkunternehmer (Dreiecksverhältnis)
a)Inbound
b)Outbound
III.Risikoanalyse im Zweipersonenverhältnis („Solo-Selbstständige“)
1.Internationale Zuständigkeit (IZPR)
a)Zuständigkeiten bei Arbeits- und Dienst-/Werkverträgen
aa)Objektive Zuständigkeiten: Erfüllungs- vs. Arbeitsort
bb)Individuell: Einschränkungen bei Gerichtsstandsvereinbarungen im Arbeitsvertrag
b)Statusabgrenzung im IZPR: Der unionsrechtliche Arbeitnehmerbegriff
2.Anwendbarkeit ausländischen Rechts (IPR)
a)Vertragsstatut bei Arbeits- und Dienst-/Werkverträgen
aa)Objektives Vertragsstatut: Aufenthalts- vs. Arbeitsort
Читать дальше