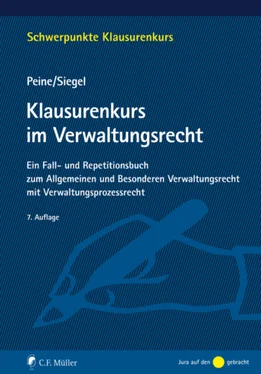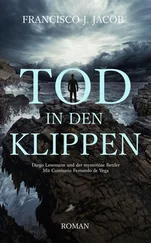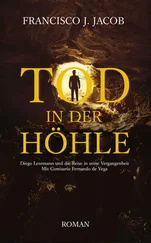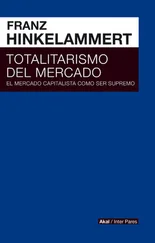1 ...6 7 8 10 11 12 ...33 38
In einigen wenigen Punkten ist die Rangfolge jedoch ausnahmsweise optional. So wird die Zuständigkeit des Gerichtsnach §§ 45 ff. VwGO oftmals nach der statthaften Verfahrensart geprüft[1]. Dies ist deshalb sachgerecht, weil im Rahmen des § 52 VwGO, welcher die örtliche Zuständigkeit bestimmt, nach den einzelnen Klagearten differenziert wird. Teilweise wird die Zuständigkeit des Gerichts aber auch im unmittelbaren Anschluss an die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs eröffnet[2]. Für einen solchen Aufbau spricht die funktional enge Verschränkung dieser beiden Prüfungspunkte. Gleichwohl wird im Folgenden grds. der „spätere“ Prüfungszeitpunkt gewählt, da dieser den meisten Musterlösungen zugrundeliegt. Weist jedoch ein Bundesland ausnahmsweise nur ein Verwaltungsgericht auf[3] und entfällt damit eine Differenzierung im Rahmen des § 52 VwGO, so ist wegen der Sachnähe der frühere Prüfungszeitpunkt zu wählen.
39
Ähnlich verhält es sich mit den beteiligtenbezogenen Sachentscheidungsvoraussetzungen, also der Beteiligtenfähigkeit nach § 61 VwGO, der Prozessfähigkeit nach § 62 VwGO sowie der Postulationsfähigkeit nach § 67 VwGO. Sie werden ebenfalls oftmals im Anschluss an die statthafte Verfahrensart geprüft[4]. Dafür spricht, dass zuvor die passive Prozessführungsbefugnis zu prüfen ist[5] und die insoweit einschlägige Regelung des § 78 VwGO[6] auf Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen beschränkt ist. Ebenso vertretbar erscheint es jedoch, die beteiligtenbezogenen Sachentscheidungsvoraussetzung wegen ihrer allgemeinen Natur bereits vor der statthaften Antragsart zu prüfen[7]. Ein solcher Aufbau ist insbesondere in denjenigen Bundesländern empfehlenswert, die trotz der Möglichkeit nach § 78 Abs. 1 Nr. 2 VwGO auf eine Einführung des Behördenprinzips verzichtet haben[8]. Denn dort verbleibt es in jedem Falle – und damit unabhängig von der Verfahrensart – beim allgemeinen Rechtsträgerprinzip. Wegen des bundeslandübergreifenden Ansatzes dieses Buches soll jedoch auch hier der spätere Prüfungszeitpunkt gewählt werden.
[1]
Etwa bei Schenke , VwProzR, 17. Aufl. 2021, Rn. 79.
[2]
Etwa bei Hufen , VwProzR, 11. Aufl. 2019, § 14 Rn. 117.
[3]
Dies ist etwa in Berlin der Fall; hierzu Siegel , in: ders./Waldhoff, ÖR in Berlin, 3. Aufl. 2020, § 2 Rn. 44.
[4]
Etwa bei Schenke , VwProzR, 17. Aufl. 2021, Rn. 79.
[5]
Erst wenn der „Verfahrensgegner“ feststeht, kann dessen Beteiligten- und Prozessfähigkeit ermittelt werden.
[6]
Dies entspricht der überwiegenden Ansicht, vgl. etwa Hufen , VwProzR, 11. Aufl. 2019, § 12 Rn. 30. Insbes. in Bayern hält sich jedoch hartnäckig die Ansicht, dass § 78 VwGO die Passivlegitimation regele und damit im Rahmen der Begründetheit zu prüfen sei, so etwa Würtenberger/Heckmann , VwProzR, 4. Aufl. 2018, Rn. 683.
[7]
So etwa bei Hufen , VwProzR, 11. Aufl. 2019, § 14 Rn. 117.
[8]
Dies ist etwa in Berlin der Fall; hierzu Siegel , in: ders./Waldhoff, ÖR in Berlin, 3. Aufl. 2020, § 2 Rn. 45.
2. Teil Repetitorium im Verwaltungsprozessrecht› 2. Kapitel Aufbaufragen› C. Das Grundschema – Sachentscheidungsvoraussetzungen
C. Das Grundschema – Sachentscheidungsvoraussetzungen
40
| I. |
Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs – § 40 Abs. 1 S. 1 VwGO |
| II. |
Statthafte Verfahrensart (Anfechtungs-, Verpflichtungs-, Leistungs-, Gestaltungs- oder Feststellungsklage sowie Normenkontrollantrag und Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz) – §§ 42 Abs. 1, 43 Abs. 1, 47, 80, 123 VwGO |
| III. |
Verfahrensartabhängige Sachentscheidungsvoraussetzungen |
| IV. |
Sachliche, instanzielle und örtliche Zuständigkeit des Gerichts – §§ 45 ff. VwGO |
| V. |
Beteiligtenbezogene Sachentscheidungsvoraussetzungen – §§ 61 ff. VwGO |
| VI. |
Ordnungsgemäße Klageerhebung/Antragstellung – §§ 81 ff. VwGO |
| VII. |
Allgemeines Rechtsschutzbedürfnis |
| VIII. |
Fehlen der Rechtshängigkeit und einer rechtskräftigen Entscheidung |
41
Zunächst erfolgt auch hier eine Vorbemerkung zur Terminologie. Oftmals wird der Begriff der Zulässigkeitsvoraussetzungenverwendet und dieser auf die Prüfung des Rechtswegs und der Zuständigkeit erstreckt[1]. Sachgerechter erscheint jedoch der Oberbegriff der Sachentscheidungsvoraussetzungen[2]. Ist nämlich der Verwaltungsrechtsweg nicht eröffnet oder wird ein unzuständiges Gericht angerufen, so erfolgt keine Abweisung als unzulässig, sondern gemäß § 17a GVG iVm § 83 VwGO die Verweisung an den richtigen Rechtsweg bzw. das zuständige Gericht. Beide Begriffe sind jedoch gut vertretbar. Nicht gewählt werden sollte in diesem Zusammenhang hingegen der Begriff der „Prozessvoraussetzungen“. Denn er würde suggerieren, dass es von vornherein zu keinem Prozess kommt. Auch das Vorliegen der Sachentscheidungsvoraussetzungen ist jedoch in einem „Prozess“ zu prüfen. Liegen die Sachentscheidungsvoraussetzungen nicht vor, so ist im Falle der Nichteröffnung des Verwaltungsrechtswegs sowie der Anrufung eines unzuständigen Gerichts nach dem Gesagten zu verweisen. Fehlt hingegen eine der sonstigen Sachentscheidungsvoraussetzungen, ergeht ein sog. Prozessurteil. Der Begriff beruht auf der Erwägung, dass das Gericht lediglich zu den Sachentscheidungsvoraussetzungen und nicht zur Sache selbst entschieden hat. Der Gegensatz ist Sachurteil, indem auch über die Sache und damit über die Begründetheit entschieden wird.
42
Um keine Sachentscheidungsvoraussetzungen handelt es sich bei der objektiven Klagehäufungnach § 44 VwGO und der Beiladungnach § 65 VwGO[3]. Denn in beiden Fällen wird die Klage bzw. der Antrag nicht als unzulässig abgewiesen[4]. Liegen die Voraussetzungen für eine objektive Klagehäufung nach § 44 VwGO nicht vor, werden die Verfahren getrennt[5]. Und im Falle einer zuvor übersehenen Beiladung kann nachträglich beigeladen werden[6]. Daher empfiehlt sich eine Erörterung beider Aspekte zwischen den Sachentscheidungsvoraussetzungen und der Begründetheit (s.u. Rn. 75).
[1]
So etwa bei Schenke , VwProzR, 17. Aufl. 2021, Rn. 79.
[2]
So etwa bei Hufen , VwProzR, 11. Aufl. 2019, § 10 Rn. 3.
[3]
Anders noch die Vorauflage unter Rn. 106 ff.und Rn. 116.
[4]
Hufen , VwProzR, 11. Aufl. 2019, § 14 Rn. 14.
[5]
Kopp/Schenke , VwGO, 26. Aufl. 2020, § 44 Rn. 8.
[6]
Kopp/Schenke , VwGO, 26. Aufl. 2020, § 65 Rn. 41.
I. Die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs (§ 40 Abs. 1 S. 1 VwGO)
43
Viele Schemata[1] beginnen mit dem Prüfungspunkt Deutsche Gerichtsbarkeit. Denn er bildet die logische Vorfrage zur Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs. Andere lassen ihn weg. Dies ist vor dem Hintergrund zu sehen, dass dieser Prüfungspunkt in verwaltungsrechtlichen Klausuren selten eine Rolle spielt[2]. Beantwortet wird die Frage nach der deutschen Gerichtsbarkeit in den §§ 18–20 GVG, auf die § 173 VwGO verweist. Wegen der Einzelheiten kann auf die einschlägigen Kommentierungen verwiesen werden[3].
44
Die Frage nach der Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs[4] ist nur deshalb zu stellen, weil es in Deutschland mehrere Gerichtszweigegibt, die von einander unabhängig sind. Die unterschiedlichen Gerichtszweige mit unterschiedlichen Rechtswegen sind historisch überkommen. Es gibt die ordentliche Gerichtsbarkeit: Sie behandelt die privatrechtlichen Streitigkeiten sowie strafrechtliche Fälle. Neben ihr existiert die Arbeitsgerichtsbarkeit: Sie befasst sich mit Streitigkeiten aus dem Arbeitsverhältnis. Davon zu trennen ist die Verwaltungsgerichtsbarkeit: Sie gliedert sich in eine allgemeine und in eine besondere Verwaltungsgerichtsbarkeit; zur letzteren zählen die Sozialgerichtsbarkeit und die Finanzgerichtsbarkeit. Unabhängig von diesen Gerichten gibt es die Verfassungsgerichtsbarkeit des Bundes und der Länder.
Читать дальше