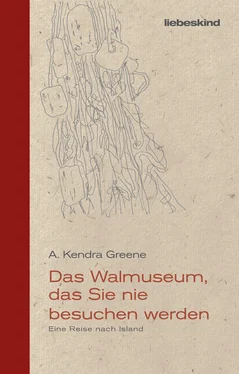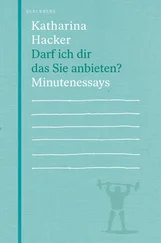Aus einer bestimmten Perspektive ist es geradezu traditionell. Denn wie viele Museen gäbe es ohne individuelle Sammler oder Amateur-Naturforscher? Beide sind grundlegende und allgegenwärtige Säulen der Museumsgeschichte. Und überhaupt ist das Ungewöhnliche an sich doch eine Museumstradition. Willst du einen menschlichen Backenzahn sehen, der wie ein knöcherner Kamm im Schädel eines Hahns steckt? Du willst eine hermaphroditische Riesenmotte bestaunen, bei der ein Flügel Größe und Muster des Männchens und der andere des Weibchens hat? Du willst einen Edelstein in einer Farbe betrachten, von der du nicht wusstest, dass sie existiert? Ein Mineral, das sich ganz von allein aufgrund seiner Zusammensetzung zu einem perfekten Würfel geformt hat? Einen lebendigen Baum, der so gezogen und gestutzt wurde, dass im Inneren ein Raum entstanden ist, den man betreten kann? Eine Nachricht aus der Feder von Elvis Presley an Richard Nixon auf Airline-Briefpapier? Alte Valentinskarten mit rassistischen Pointen? Das Netz, das eine Spinne im Weltraum gesponnen hat? Jenen Löffel, den die Insassin eines Sanatoriums verschluckt hat, weil eine Operation besser als ihr sonstiges Leben war? Du willst überrascht werden? Dann geh in ein Museum.
DAS MUSEUM WIRD ZUM TEIL von einer Reihe von Hodensack-Hautlampen beleuchtet. Wir stehen direkt unter ihnen, als Sigurður nach oben zeigt. Er erklärt, dass es eine Weile gedauert hat, bis er die richtige runde Form gefunden hatte, um die Haut beim Trocknen zu dehnen. Er deutet auf einen seiner frühen Versuche, und als ich in ihren Schein hinaufschaue, sehe ich Geometrie. Ich frage mich, wie klein man einen Fußball machen kann, als er wissen will, ob ich das Muster erkenne. Die Haut ist dichter, wo sie eingedrückt ist. Das Licht leuchtet dunkler an diesen Falten, und es dämmert mir, dass die Lampenhaut über einen Handball gespannt wurde, um sie zu dehnen, und dass sie das Muster des Balls angenommen hat.
Überall auf der Welt gibt es Dinge wie Penisschreine, Penisskulpturen und Penisfestivals. Es gibt das chinesische Museum für Sexualkultur sechzig Meilen nordwestlich von Shanghai, das Musée de l’Érotisme in Paris und dazu noch ein Dutzend andere in Amsterdam, New York, Tokio und weiß Gott wo. Aber dies ist genauso wenig ein Museum über Sex wie über das Urinieren. Es ist kein Museum der Funktion, sondern der Form, und oft ist nicht einmal der komplette Apparat intakt, sondern nur das, was man abschneiden, was man aufbewahren kann.
Vielleicht nähern wir uns damit dem Grund dafür, warum es so wenige Museen gibt, die auf einzelne anatomische Teile spezialisiert sind. Es gibt die Nasenakademie im Museum für studentisches Leben an der schwedischen Universität Lund. In einem Krankenhaus in Dallas ist die private Sammlung eines Chirurgen mit Bronzeabgüssen von Promi-Händen ausgestellt. Wenn man sich lange genug im Phallologischen Museum aufhält, wird irgendjemand die Frau erwähnen, die in Europa ein Vagina-Museum plant, doch es soll ein Museum für Vagina-Kunst werden, nicht für vaginale Präparate. Oder jemand fragt den Kurator: »Wissen Sie, dass Sie einen Kollegen in den Niederlanden haben?« Es ist ein Hodensammler, wie sich herausstellt. Nur von Tieren, und im Gegensatz zum IPS ist seine Kollektion unbedeutend, ja nicht einmal ein Museum.
Gerade als ich beginne, mich zu fragen, wann genau die vergleichende Anatomie aus der allgemeinen Vorstellungswelt verschwunden ist – weshalb wir diese Wissenschaft vergessen haben, die so alt ist wie die Antike, ihre Beiträge zur Evolutionsbiologie, zur Phylogenese und zur vergleichenden Genomik, das Lebenswerk von Cuvier und Huxley, die Grundlage für Darwin, wie Edward Tyson feststellte, dass ein Schweinswal und Wale allgemein Säugetiere sind, und wie das der Welt die Augen öffnete –, ist das Gespräch bereits zur Geografie übergegangen. Ob ich wüsste, dass im finnischen Tampere traditionell penisförmige Pralinen hergestellt würden?
»Man schenkt sie den Damen.«
Diese Information erhalte ich von einem Bewohner besagter finnischer Stadt, einem Mann, der gerade seine beiden Söhne fotografiert hat. Das Fotografieren ist im Museum erlaubt. Die Besucher dürfen blitzen, so viel sie wollen. Der Finne hat die Jungen, erst den größeren, dann den kleineren, neben das Exemplar A-2-h gestellt: den Phallus eines erwachsenen Pottwals, der im Jahr 2000 lebend in Hrútafjörđur gestrandet ist. Der Wal war bei seinem Tod 15,8 Meter lang und starb an einem Darmverschluss. Nur die Spitze des Penis wurde abgenommen, doch mit 170 Zentimetern und siebzig Kilogramm ist sie ein beliebter Hintergrund für Porträts, zumal sie auch ein wenig größer ist als die meisten Menschen, die sich mit ihr fotografieren lassen. Wäre sie aus Messing, würde die Spitze sicherlich hell glänzen und ein Band um ihre Rückseite verlaufen, dort, wo ein grinsender Besucher nach dem anderen einen Arm um sie legt wie ein alter Schulkamerad. Die Besucher benehmen sich hier so wohlerzogen wie in jedem anderen Museum auch, aber mir fällt auf, dass die Frauen, ja, besonders die Frauen, Gegenstände berühren. Die Männer, so beobachte ich, machen lieber Fotos.
Der Finne hinterlässt eine Karte am Schreibtisch des Kurators und sagt, er solle den Chocolatier anrufen, vielleicht würde er eine Form spenden. Er sammelt seine Jungs und seine Kameraausrüstung ein und geht zur Tür. Im Hinausgehen sagt er, als ob das jemanden interessieren würde: »Sie machen sie auch aus weißer Schokolade.«
ES GIBT ZAHLREICHE GLÄSER, und sie sind mit allen Arten von Deckeln verschlossen: Marmeladen- und Senf- und Essiggurkengläser, ausgewaschen und mit Proben gefüllt, die Metalldeckel anschließend wieder aufgeschraubt und zugeklebt. Es gibt Einmachgläser, die mit orangefarbenen Gummiringen luftdicht verschlossen wurden. Ohne die Etiketten würde ich glauben, dass eine Sammlung von Meeresschnecken und Knollen unter die Penisse gemischt wurde, so viele der Formen sind mir eher als Wasserfauna und -flora vertraut.
Capra hircus , die Ziegenexemplare, sind auffällig behaart. Sie sehen selbst aus wie Tiere, wie kleine Opossums, die sich zusammengerollt haben und schlafen. Der getrocknete Phallus eines alten Ebers, der auf einen Stein montiert ist, gleicht einer knospenden Wüstenblume. Der Penisknochen des Stinktiers hat den Schwung und die Lappen einer Taglilie, während die Penisknochen junger grönländischer Robben so dünn und hellbraun wie Streichhölzer sind.
Vielleicht weil er in einem Glasgefäß mit Metalldeckel untergebracht ist, das identisch ist mit dem Set, in dem der verfaulte Phallus eines Grindwals mit langen Flossen aufbewahrt wird, nehme ich an, dass ein Narwalstoßzahn nur ein weiteres Baculum ist, bis ich das Etikett genauer lese und erkenne, dass der Elfenbeinkegel kein Penisknochen, sondern ein Zahn ist. Sicher, es ist ein Zahn, der höchstwahrscheinlich von einem Männchen stammt – obwohl manchmal auch den Weibchen welche wachsen –, aber warum ist er hier?
Zu diesem Rätsel kommt noch eine andere Enttäuschung hinzu. Wer käme bei den vier gezeigten Katzen-Penisknochen jemals auf die Idee, dass der fleischige Phallus, der den Knochen umgibt, mit Widerhaken versehen ist? Wenn wir schon über Penisse reden, ist das dann nicht eine Sache, die man wissen sollte?
DAS WICHTIGSTE IST, die Nachrichten zu hören. Es kommt in den Nachrichten, wenn Wale stranden und Eisbären anlanden, und dann muss man ein paar Telefonate führen. Aber es funktioniert auch in umgekehrter Richtung: Die Leute rufen das Museum an, und dann kommt das Museum in die Nachrichten. »Wir haben ein Walross!«, sagt der Anrufer, oder das Boot hat gerade etwas hereingebracht. Ein Bauer aus der Nachbarschaft verliert seinen preisgekrönten Hengst und bittet, eine Spende in memoriam anzunehmen.
Niemand bezeichnet es als Zusammenarbeit, aber die Sammlung war und ist abhängig von guten Kontakten, einem Netz von Beziehungen. Sigurður hätte gerne ein besseres Eisbärenexemplar, aber, wie er sagt, »Grönländer sind noch schlimmer als Isländer – sie antworten nie auf einen Brief«.
Читать дальше