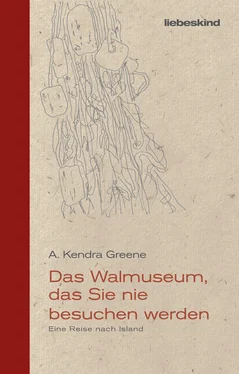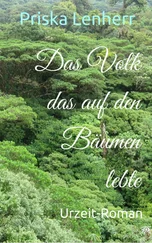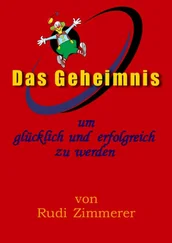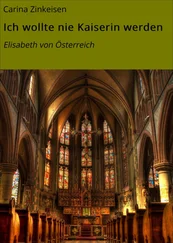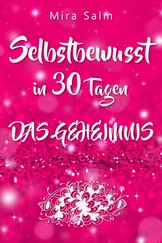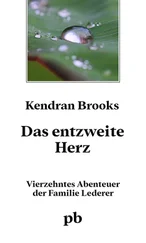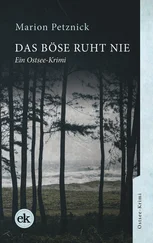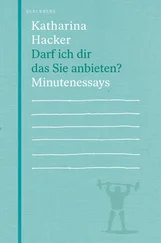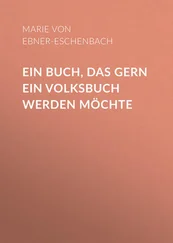Die kleinen Schilder für die Herren- und die Damentoilette sind nicht einheitlich. Das der Männer besteht aus einer Holzschindel, die mit einem nackten Jungen bemalt ist, der in eine Schüssel pinkelt. Die Ausführung ist ein wenig grob, die Bedeutung jedoch unverkennbar. Die Damentoilette hingegen ist diskreter, geheimnisvoller, gekennzeichnet durch ein Porzellanoval, das eine viktorianische Dame zeigt, vollständig bekleidet, vom bodenlangen Kleid und dem hohen Rüschenkragen am Hals bis zu den behandschuhten Händen. Im Gegensatz zu dem nackten Jungen gibt sie keinen Hinweis auf den Zweck des Raumes, sondern deutet nur schüchtern an, dass man hinter dieser Tür vielleicht – wer weiß? – einen Spaziergang auf dem Land machen oder seine Stiefel neu schnüren könnte, ohne jemandem schamlos einen Knöchel zu zeigen.
Wenn man Sigurður fragt: Warum keine Vaginas, warum nicht generell ein Museum für Genitalien?, antwortet er einem mit dem Augenzwinkern eines Mannes, der seit etwa fünfzig Jahren verheiratet ist: »Frauen sind in jeder Hinsicht komplizierter als Männer.« Er meint das nicht spitzfindig. Na ja, vielleicht doch, aber es gibt auch ganz praktische Gründe. Es ist schon eine technische Herausforderung, das betont Konvexe zu zeigen, und was ein Museum zeigen kann, hat viel mit dem zu tun, was es bewahren kann. Dieses Museum ist, möglicherweise in erster Linie, eine Studie über Konservierung. Und die besteht in diesem Fall aus einer Reihe von Experimenten.
Die ersten beiden Walpenisse, von einem Finnwal und einem Seiwal, wurden erst mit Silikon gefüllt und dann mit Salz, um das Fett wegzuätzen. Sigurður räumt ein: »Das hätte ich nicht tun sollen.« Aber irgendetwas musste natürlich geschehen. Die Uhr tickte. Der Kurator traf also eine Entscheidung, und zwar schnell, und gerechterweise muss gesagt werden, dass das Ergebnis vierzig Jahre überdauert hat, auch wenn die Haut des Seiwals jetzt auf der linken Seite in einem mäandernden Kringel aufgerissen ist, auseinandergezogen wie die Ufer eines trägen Flusses.
Ein weiterer Seiwalphallus wurde auf eine andere Art konserviert. Das Exemplar ist in der Mitte gebogen und zusammengeklappt, damit er in ein Einmachglas passt, das zwar vom Volumen, aber nicht von der Länge her genügte. Auswahlmöglichkeiten gibt es tatsächlich viele: Während der Penis eines Zwergwals ausgehöhlt, gesalzen und getrocknet auf einer Holzplatte platziert wurde, blieb ein anderer intakt, komplett mit Retraktor-Muskeln und Beckenknochen, und ruht in einem eigenen Aquarium wie ein abnormaler Nautilus, die Glasplatte darüber voller trüber Kondensationstropfen, das innere Gewebe fiedrig austretend wie fransiger Stoff.
Bei jeder Art der Konservierung leidet das Exponat in gewisser Weise und stellt keinen lebensechten Zustand dar. Sich auflösendes Gewebe trübt das Formalin in Form von Flocken und flauschigen Blüten. Die Haut eines Pottwalphallus ist geschrumpft, sodass der Holzkern hervorschaut; eine dünne, schwarz gesprenkelte Dermis, der Rest ist zu Wildleder geworden. Ein sechzig Pfund schwerer Blauwalpenis, der einst kaum auf den Rücksitz eines Autos passte, ist nun zottelig und hat sich auf ein Drittel seiner Größe verkleinert. Das Formalin im Behälter eines anderen Blauwalexemplars wurde dreimal gewechselt, um das Blut und das Öl zu entfernen, zuletzt vor drei Jahren, doch seitdem ist erneut so viel Öl aus dem Organ ausgetreten, dass es eine fingerdicke Fettschicht bildet, die wie eine Bernsteinplatte vierzig Zentimeter unter dem gläsernen Deckel schwimmt.
Formalin wirkt, weil es tötet. Es ist furchtbar giftig. Lässt man eine Flasche mit Formaldehyd fallen, mit der man gerade hantiert, bleiben einem fünf, vielleicht sechs Sekunden, um aus dem Raum, aus dem Gebäude zu kommen. Man verwendet es grundsätzlich verdünnt. Schon eine 3,5-prozentige Formalinlösung reicht aus, um eine Probe für immer zu konservieren; sie tötet alle Bakterien und Pilze ab, die sonst das Gewebe zersetzen könnten. Sigurður musste in den 1970er-Jahren eine Genehmigung für das Zeug einholen, aber seitdem hat ihn keine Behörde mehr kontrolliert.
Es dauert zwei bis drei Tage, bis das Formalin ein Exemplar versteift hat. Hoffentlich hat man es richtig positioniert, und hoffentlich hat man es warm bekommen, damit es ganz ausbluten konnte. Nachdem das Formalin seine Arbeit getan hat, kann das Exponat in Alkohol gelagert werden. Alkohol ist zwar viel sicherer, aber auch teurer als Formalin, von daher macht sich nicht jeder diese Mühe.
Sigurður sammelt übrigens auch noch andere Dinge: Bücher, Musik, Käfer sowie präkolumbianische und indigene südamerikanische Kunst. Seine vier Kinder und deren Freunde interessierten sich früher am meisten für die Käfersammlung, obwohl sich im Schuppen die Phallus-Exemplare häuften. Ein Jahr lang reiste die Familie durch Mexiko, besuchte Museen und Bibliotheken und alles, was ihr Interesse weckte. Und nur mit ein wenig Baumwolle, die in Formaldehyd getupft wurde, bändigten und sammelten sie nach Herzenslust Spinnen und mehr Insekten, als sie benennen konnten.
Insekten – das weiß jeder, der hin und wieder in den Ecken abstaubt – trocknen ganz hervorragend. Sie konservieren sich praktisch von selbst. Ein Hoch auf das trostlose Exoskelett für die simple Illusion einer dauerhaften Form! Wir neigen das Haupt voller Mitleid vor jenen Kuratoren, die sich endlos abmühen, ein Pfund Fleisch zu konservieren.
DAS ERSTE, WAS ICH SEHE, als ich das Museum betrete, ist ein halb nackter Mann. Nicht etwa als Fotografie, Gemälde oder als Skulptur, sondern da steht ein richtiger Mann mit roten Haaren und nacktem Oberkörper. Ein durchtrainiertes Exemplar, Anfang zwanzig, und als ich die Treppe hinaufsteige, erblicke ich einen zweiten Mann in exakt demselben Zustand der Entkleidung.
»Medium«, verkünden sie dem Kurator. Der Kurator scheint nichts Ungewöhnliches an diesem Auftritt zu finden, sagt nichts und geht in ein Hinterzimmer. Als er zurückkommt, bezahlen die beiden hemdlosen Schotten zwei T-Shirts, eines mit dem IPM-Logo und das andere mit dem Namen des Museums in sieben verschiedenen Sprachen.
Der Kurator deponiert ihre Kronen in einer hölzernen Geldkassette, die aus guter isländischer Birke geschnitzt ist und einen Phallus von der Größe einer Brotdose darstellt. Da ich gerade unbeschäftigt bin, bitten sie mich, sie zu fotografieren. Der Rotschopf zeigt mir, wo ich mich hinstellen soll, damit sie vom Killerwal- und dem Pottwalexemplar eingerahmt werden. Als die beiden Männer ihre Hosen runterlassen, drücke ich den Auslöser.
Der Rothaarige, so stellt sich heraus, ist Zoologe und sein Freund Biologe, und sie brauchen dieses Foto für ihre Schwimmmannschaft. Sie erzählen mir, dass es bei ihnen Tradition ist, im Urlaub in der Mannschaftsbadehose vor Denkmälern und Sehenswürdigkeiten zu posieren. »Den Pyramiden von Gizeh, den Mayatempeln in Mexiko, dem Parthenon …«
»Einer wurde letztes Jahr vor dem Weißen Haus verhaftet«, sagt der Schotte mit einer Mischung aus Neid und Stolz. »Wir haben gehofft, dass wir hier rausgeworfen werden, damit wir erzählen können: ›Wir wurden aus dem Penismuseum rausgeschmissen‹, aber dieser Typ«, sagt er und nickt dem Kurator zu, »ist einfach zu nett!«
Sigurður Hjartarson ist eigentlich eher für seine schroffe Art bekannt als für seine Schlagfertigkeit, für seine kleidsamen Hosenträger oder die Totenköpfe in seinem Arbeitszimmer zu Hause. Doch vielleicht ist er nach 131 Artikeln und einem Dokumentarfilm über sein Museum einfach nur die immer gleichen Fragen leid. Siebenundzwanzig Länder auf mindestens vier Kontinenten haben Artikel über das Isländische Phallologische Museum veröffentlicht. Diejenigen in Sprachen, die ich lesen kann, charakterisieren es wechselweise als seltsam, verrückt, kauzig, infam, einzigartig und sadistisch. Meist klingt der Tenor schon im Titel an, und vermutlich sollte ich mich nicht daran stören, aber während ich durch die Archive des Museums blättere – neun Sammelbände in einem Bücherregal, in dem »Wale, Delfine und Schweinswale« neben »Sexualia: von der Vorgeschichte bis zum Cyberspace« stehen –, regt es mich allmählich auf und ärgert mich, wie selten offenbar jemand bemerkt, was für ein ansprechendes kleines Museum das hier ist. Es ist kurios, das stimmt, aber auch einnehmend exotisch, gemütlich vertraut, mit Stühlen zum Ausruhen und Erklärungsbroschüren, und es ist klugerweise auf die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne von uns Menschen ausgelegt. Und, seien wir ehrlich, so seltsam ist es eigentlich gar nicht.
Читать дальше