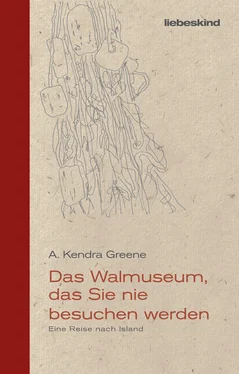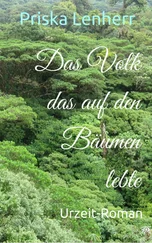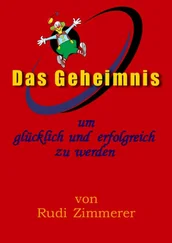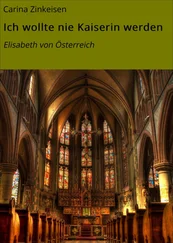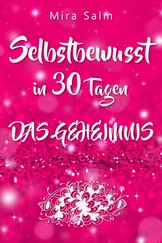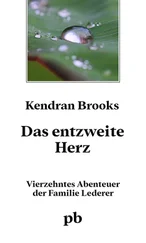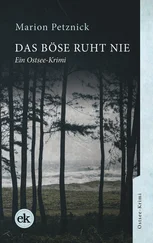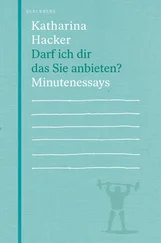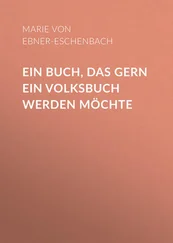Die Männer in unserer Gruppe kicherten. Sie hatten sich tatsächlich schon eine Weile gewundert und waren froh um eine Erklärung. Für mich dagegen war es ein Aha-Erlebnis auf einer ganz anderen Ebene. Ich hatte es nicht bemerkt. Normalerweise hätte ich in einem Saal mit nackten Statuen einen Weg gefunden, meinen Blick beiläufig, aber bewusst zu lenken, sodass weder mein Hinsehen noch mein Wegsehen bemerkt worden wäre. Doch diese neue Information veränderte etwas: Ich hatte das Gefühl, hinschauen zu dürfen. Oder besser: nicht nur hinschauen, sondern mustern zu dürfen, ja, zu müssen. Schon der Unterschied in der Ausführung der Bauchnabel bei den Figuren im Zeustempel in Olympia zeigt, dass die Giebelskulpturen an der Vorderseite des Tempels von einer anderen Werkstatt gefertigt wurden als die von der Rückseite abgewandten. Ich lernte daraus, dass Einzelheiten wichtig sein können und man stets die Augen offen halten muss. Es hängt tatsächlich viel davon ab, ob ein Nabel nach innen oder außen gewölbt ist. Und auf die Penisgröße, so stellte ich erstaunt fest, kommt es eben doch an.
DER ALKOHOL WARein wichtiger Katalysator. Man kann keinen Walpenis geschenkt bekommen, da sind wir uns wohl einig, ohne dass die Freunde davon erfahren. Nicht in einer Stadt mit fünftausend Einwohnern. Nicht, wenn die Freunde auch Trinkkumpane sind. Und es ist wahrscheinlich auch egal, dass die Freunde Akademiker und Parlamentsmitglieder sind – irgendjemand reißt garantiert einen Witz, ja, man kann sich die Witze immer schwerer verkneifen. Die Freunde werden sie ständig einstreuen. Das ist ganz normal. Man kann nichts dagegen tun. Die Scherze werden virulent. Und egal, für wie gelehrt oder distinguiert man sich hält, man wird feststellen, dass jedes Mal die Stimmung steigt, wenn man über ein Penismuseum redet. Irgendwann wird man – zwangsläufig – seinen Reizen erliegen.
Und so ging es auch in der Kneipe in Akranes. Ehe man sichs versah, scherzten Sigurður und seine Freunde über die Feinheiten der Organisation einer imaginären Einrichtung. Sie erfanden ein isländisches Akronym für das Phallologische Museum: RIS/HIS, ein Wortspiel, das übersetzt so viel bedeutet wie »sich glücklich erheben«. Das englische Wort phallological ist Sigurðurs eigene Erfindung, aber einem Lateinlehrer seiner Schule schreibt er die Bezeichnung Phalloteca für die hypothetische Institution zu. Es herrschte allgemeine Großzügigkeit und jeder Beitrag wurde mit Ehrentiteln der nicht existierenden Institution belohnt, bis jeder von ihnen zumindest zu einem ordentlichen Mitglied in gutem Ansehen erklärt wurde.
Natürlich wurde nichts davon ernsthaft als Möglichkeit in Betracht gezogen. Doch die Tatsache, dass es überhaupt eine Möglichkeit gab, egal wie zweifelhaft sie war, veränderte manches. Das Isländische Phallologische Museum rückte, wenn auch nur vage, in den Bereich des Realisierbaren. Es hatte die besondere Kraft von einem Ding mit Namen bekommen. Die Sammlung mag mit einer Peitsche begonnen haben, aber das Museum, so kann man wohl mit Sicherheit behaupten, wurde an einer Bar aus der Taufe gehoben.
Die Freunde waren nicht gerade begnadete Propheten. Keiner an der Bar sagte: »Wäre es nicht toll, wenn deine Tochter und deine Schwiegertochter in ihrem Kinderkleiderladen ein bisschen Platz für dein Museum hätten und du beim Benoten von Arbeiten Penis-Souvenirs schnitzen könntest?« Doch genau so kam es. Die Frauen hatten Probleme, die Miete zu bezahlen, also boten sie Sigurður die Hälfte des etwa 350 Quadratmeter großen Ladenlokals in einer hübschen kleinen Gasse neben der Haupteinkaufsstraße von Reykjavík an. Sigurður sammelte inzwischen seit über zwanzig Jahren und hatte männliche Fortpflanzungsorgane von vierunddreißig der sechsunddreißig Säugetierarten Islands zu Hause liegen. Warum also nicht? Er zog mit zweiundsechzig Exemplaren in seine Hälfte des Ladens, und am 23. August 1997 öffnete das Isländische Phallologische Museum seine Pforten. Es war Sigurðurs sechsundfünfzigster Geburtstag.
DER ERSTE ARTIKEL über die Sammlung erschien siebzehn Jahre, bevor es ein Museum zu besuchen gab. Der ursprüngliche Schwerpunkt der Sammlung waren Walpenisse, und im Jahr 1980 konnte bereits über dreizehn Exemplare berichtet werden. Eine Reykjavíker Zeitung brachte folgende Schlagzeile: 30 KG WALPENIS IN EINER PLASTIKTÜTE GELIEFERT.
Als ich Sigurður frage, wie aus einer Sammlung ein Museum wird, zuckt er mit den Schultern. Die gleiche Reaktion ernte ich bei dem pensionierten Professor vom Vulkanmuseum draußen auf der Snæfellsnes-Halbinsel, ja, im Grunde in jedem Museum, egal wo in diesem Land. Tja, wer weiß?, soll das heißen. Die Lokalzeitung findet etwas über dein Spezialgebiet heraus und schreibt darüber, die Leute fragen, ob sie sich deine Schätze mal ansehen dürften, sie vereinbaren Besuchstermine, und so reift die Idee, nimmt Gestalt an. Mit jeder Anfrage wird die private Sammlung ein bisschen öffentlicher. Und dann, eines Tages, geben dir Fremde Geld.
In Sigurðurs Fall ruft vielleicht ein Mitglied eines örtlichen Frauenvereins an, das einen gemeinsamen Ausflug zu ihm arrangieren will, oder ein Freund, der Besucher aus dem Ausland beherbergt, möchte vorbeikommen. In Island wird ein Junggesellinnenabschied als »Gänseparty« bezeichnet, und auch die Gänsepartys begannen, sich zu melden.
Vielleicht bedeutet es nichts (ich bin mir fast sicher, dass es so ist), aber ich möchte anmerken, dass sämtliche Reden zur Eröffnung des Museums von Frauen gehalten wurden. Die Männer – all die Schriftsteller und Parlamentarier, die linksgerichteten, biertrinkenden Männer, die jahrelang über das Museum geredet und seine Planung vorangetrieben hatten – schwiegen. Sie standen am Rande und klatschten. Es war, als gäbe es zu diesem Zeitpunkt nichts mehr zu sagen. Ihre Worte hatten bereits ihr Ziel erreicht, ihnen ihren Platz zugewiesen, und vielleicht war das genug, um sie sprachlos zu machen.
Nur einer von ihnen, ein Musiker, hatte etwas zu bieten: eine Originalkomposition, die er später am Abend vortrug, als sich alles beruhigt hatte, die Reden vorbei waren und die Gespräche sich vielleicht wieder weniger ernsten Themen zuwandten.
DAS ISLÄNDISCHE PHALLOLOGISCHE Museum ist kleiner, als man denkt. Die Sammlung von 212 Exemplaren hiesiger Tiere passt in einen Raum. Die vierundsechzig Exemplare der ausländischen und der volkstümlichen Sammlungen teilen sich eine übergroße Nische. Und trotzdem ist es ein wenig überwältigend. Das Erste, was ich im Isländischen Phallologischen Museum tue, nachdem ich die Schwelle überschritten habe, ist innehalten, um mich zu sammeln, und dann gehe ich aufs Klo.
Selbst für die 60 Prozent der Besucher, die keinen Phallus benutzen, um sich zu erleichtern, wirkt das Wasserklosett wie eine natürliche Einführung in das Thema – und die Architektur des Museums legt diese Option nahe. Der Haupteingang öffnet sich zu einem Treppenabsatz, einem kleinen Foyer, das zwei Wege zum Weitergehen bietet. Eine Treppe nach oben links führt zu den Museumsgalerien; eine Treppe nach unten rechts (das klingt fast freudianisch) bringt einen zu einem verschlossenen Lagerraum und dem WC.
Das ist keine Absicht. Der ursprüngliche Entwurf für das Museum sah laut einer Karikatur in den Archiven einen langen Galerie-Korridor vor, der am Ende in zwei kreisförmige Räume mündete, von denen einer einen Souvenirladen und einer ein Café beherbergen sollte – eine Konstruktion nicht unähnlich dem aktuellen Design des internationalen Flughafens von Island, dessen Luftaufnahmen nach seiner Eröffnung viel kommentiert wurden. Nein, dass das Museum in dem eigentümlichen Gebäude in der Héðinsbraut 3a untergebracht ist, hat nur mit der örtlichen Bank zu tun, die dem Museum den Standort für kleines Geld anbot, froh, dass jemand in das hundert Jahre alte Haus einzog und die Zugluft eindämmte.
Читать дальше