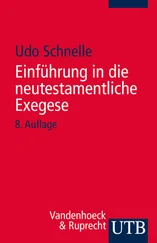Die Basis dessen, was kunstpädagogische Konzepte lange Zeit prägte und was alle kunstpädagogischen Methodenentscheidungen überhaupt erst legitimierte, wird durch diesen Ansatz radikal in Frage gestellt. »Erfahrung gelingt nicht durch Vermittlung«, sagte unmissverständlich der Kunstpädagoge Hermann K. Ehmer (Ehmer 1993, S. 32). Vermittlung gilt demnach nicht mehr als eine der Kunst angemessene Kategorie, weil der Inhalt möglicher Kunstvermittlung nicht reflexiv verfügbar ist.
Kunstlehrende geraten unversehens unter einen Rechtfertigungsdruck. Das Paradoxon, mit dem sie selbst unter Anerkennung der oben konturierten Prämisse umgehen müssen, lautet: Trotz allem versuchen sie weiterhin die Gelenkfunktion zwischen der Kunst und den Schülerinnen und Schülern bzw. den Adressatinnen und Adressaten einzunehmen – sie vermitteln ›etwas‹. Das Gewahrwerden dieses ›blinden Flecks‹ der Kunstpädagogik wird im Fach theoretisch kultiviert und gewissermaßen zu einem ›Kunstgriff‹ stilisiert (  Kap. 2.15) (Pazzini 2005). Aus Sicht der Praxis lässt sich die Wahl der Vermittlungsmethoden wohl vorwiegend als eklektisch oder noch treffender als pragmatisch bezeichnen. Das heißt, man wählt jeweils die situativ adäquat erscheinende Methode aus, die angesichts der eigenen Berufserfahrung momentan einen größtmöglichen Erfolg für kreative und produktive Anschlüsse verspricht. Die Wahl der Vermittlungsmethoden ist somit keinesfalls beliebig, d. h., zumindest im Nachhinein ist es mittels Reflexion möglich, die Wahl professionell zu begründen – unabhängig davon, ob sich die Wahl im Nachhinein auch als angemessen erwies. Es lässt sich offensichtlich der ›Kunstgriff‹ anwenden, dass Vermitteln auch angesichts der Anerkennung der Unvermittelbarkeit dessen, was Kunst ihrem Wesen nach ist, keineswegs überflüssig wird. Denn im Zentrum steht deswegen nun die Frage: Wie lässt sich die Nicht-Vermittelbarkeit der Kunst überzeugend und gegenstandsgerecht, d. h. kunstgerecht, vermitteln? Dass diese Frage so verhandelt wird, zeigt beispielsweise Hermann K. Ehmer mit seiner offenbar paradoxen Formulierung, wir müssten lernen, dass es an der Kunst nichts zu lernen gebe (Ehmer 1994, S. 14).
Kap. 2.15) (Pazzini 2005). Aus Sicht der Praxis lässt sich die Wahl der Vermittlungsmethoden wohl vorwiegend als eklektisch oder noch treffender als pragmatisch bezeichnen. Das heißt, man wählt jeweils die situativ adäquat erscheinende Methode aus, die angesichts der eigenen Berufserfahrung momentan einen größtmöglichen Erfolg für kreative und produktive Anschlüsse verspricht. Die Wahl der Vermittlungsmethoden ist somit keinesfalls beliebig, d. h., zumindest im Nachhinein ist es mittels Reflexion möglich, die Wahl professionell zu begründen – unabhängig davon, ob sich die Wahl im Nachhinein auch als angemessen erwies. Es lässt sich offensichtlich der ›Kunstgriff‹ anwenden, dass Vermitteln auch angesichts der Anerkennung der Unvermittelbarkeit dessen, was Kunst ihrem Wesen nach ist, keineswegs überflüssig wird. Denn im Zentrum steht deswegen nun die Frage: Wie lässt sich die Nicht-Vermittelbarkeit der Kunst überzeugend und gegenstandsgerecht, d. h. kunstgerecht, vermitteln? Dass diese Frage so verhandelt wird, zeigt beispielsweise Hermann K. Ehmer mit seiner offenbar paradoxen Formulierung, wir müssten lernen, dass es an der Kunst nichts zu lernen gebe (Ehmer 1994, S. 14).
1.3 Konsens im Fach – Ästhetische Erfahrung und Bildkompetenz
»Im Kunstunterricht geht es um mehr als Kunst, es geht um die ästhetischen Erfahrungsprozesse der Kinder und Jugendlichen – in ihrem Wahrnehmen, Handeln und Denken. Ihnen diese Prozesse zu eröffnen, sie darin zu begleiten und selbstständig werden zu lassen, ist Praxis und Konzept des Kunstunterrichts« (Kirchner/Otto 1998, S. 1). Mit diesen Worten charakterisierten Constanze Kirchner und Gunter Otto eine noch gültige Hauptaufgabe heutiger Kunstpädagogik. Diese Aufgabe besteht nicht in der Vermittlung von Kunst, sondern kunstpädagogische Grundintentionen zielen ab auf die Ermöglichung ästhetischer Erfahrungen im Bildnerischen. Ästhetische Erfahrungen lassen sich sowohl produktiv im eigenen bildnerischen Gestalten (  Kap. 4.1und
Kap. 4.1und  Kap. 4.2) als auch rezeptiv, etwa in der Kunstbetrachtung (
Kap. 4.2) als auch rezeptiv, etwa in der Kunstbetrachtung (  Kap. 4.3), aber auch im Alltag »in Ereignissen und Szenen« machen, »die das aufmerksame Auge und Ohr des Menschen auf sich lenken, sein Interesse wecken und, während er schaut und hört, sein Gefallen hervorrufen« (Dewey 1934/1980, S. 11), so der US-amerikanische Philosoph und Pädagoge John Dewey in seiner Sammlung von Vorlesungstexten »Art as Experience« aus dem Jahre 1934. Auf diese Grundaussagen Deweys bezieht sich die deutsche Kunstpädagogik häufig. Ästhetische Erfahrungen können als Erfahrungen der Diskontinuität, der Differenz zum bisher Erlebten gelten (Mattenklott/Rora 2004). Sie überschreiten das mittels unserer Wahrnehmung Erwartbare und »erzeugen Risse in der gedeuteten Welt« (Seel 2007, S. 59). In dieser »Schwellenphase« werden »kulturelle Spielräume für Experimente und Innovationen eröffnet« (Küpper/Menke 2003, S. 140).
Kap. 4.3), aber auch im Alltag »in Ereignissen und Szenen« machen, »die das aufmerksame Auge und Ohr des Menschen auf sich lenken, sein Interesse wecken und, während er schaut und hört, sein Gefallen hervorrufen« (Dewey 1934/1980, S. 11), so der US-amerikanische Philosoph und Pädagoge John Dewey in seiner Sammlung von Vorlesungstexten »Art as Experience« aus dem Jahre 1934. Auf diese Grundaussagen Deweys bezieht sich die deutsche Kunstpädagogik häufig. Ästhetische Erfahrungen können als Erfahrungen der Diskontinuität, der Differenz zum bisher Erlebten gelten (Mattenklott/Rora 2004). Sie überschreiten das mittels unserer Wahrnehmung Erwartbare und »erzeugen Risse in der gedeuteten Welt« (Seel 2007, S. 59). In dieser »Schwellenphase« werden »kulturelle Spielräume für Experimente und Innovationen eröffnet« (Küpper/Menke 2003, S. 140).
Strukturmomente von ästhetischer Erfahrung sind zusammengefasst, chronologisch geordnet von der ersten Aufmerksamkeit bis zur Mitteilung und abgeleitet aus den oben genannten Literaturquellen:
• Aufmerksamkeit für Ereignisse und Szenen, die Gefallen und Interesse wecken und hierdurch unmittelbares Spüren der Wahrnehmung bedingen;
• Offenheit und Neugier;
• Versunkensein und emotionales Involviertsein im Augenblick;
• Genuss der Wahrnehmung selbst und hiermit verbundenes Lustempfinden (nicht nur angenehm, sondern auch verstörend oder erschaudernd);
• Spannung und Überraschung, die Staunen vor dem wahrgenommenen Phänomen auslösen können;
• Erleben von Subjektivität und Individualität im Wahrnehmungsprozess;
• Anregung der Fantasie durch Entdeckung von neuen Assoziationen zu scheinbar Bekanntem und Gewohntem;
• Reflexion über die eigene Wahrnehmung und deren Prozesshaftigkeit mit hierdurch bedingter nötiger Distanz zum eigenen Wahrnehmungserleben, zum Abschluss der ästhetischen Erfahrung;
• Voraussetzung für die Reflexion sind Wissen und Einsicht, die sich aus früherer Wahrnehmung und Erfahrung ergeben;
• In-Beziehung-Setzen der eigenen ästhetischen Erfahrung mit kulturellen und künstlerischen Produkten;
• Festhalten der ästhetischen Erfahrung in ästhetischer Produktion;
• Mitteilen dessen, was die ästhetische Aufmerksamkeit erregte (kommunikativer Aspekt).
Deweys Auffassung steht in Opposition zu ästhetik-philosophischen und bildungstheoretischen Standpunkten, beispielsweise des Kunsthistorikers Gottfried Boehm, der es für die ästhetische Erfahrung als kennzeichnend ansieht, dass ihre Eingliederung ins Pädagogische nicht nur in Frage zu stellen sei, sondern dass die Idee einer natürlichen Annäherung von Kunst und Pädagogik ein fragwürdiges Unternehmen bleibe (Boehm 1990, S. 471). Für Boehm ist ästhetische Erfahrung nur an Kunstwerken bzw. in Verbindung mit Kunstwerken zu gewinnen. Die sich gegen einfache Erklärungen wehrende zeitgenössische Kunst – wie etwa die Erwin Wurms (  Kap. 1.1) – errichte eine schwer überwindbare Barriere gegenüber jenen Versuchen, sie zum Instrument ästhetischer Erziehung zu machen.
Kap. 1.1) – errichte eine schwer überwindbare Barriere gegenüber jenen Versuchen, sie zum Instrument ästhetischer Erziehung zu machen.
Doch ihre Beziehung zur bildenden Kunst ist für die Kunstpädagogik zwar zentral, aber nicht allgegenwärtig. Ästhetische Erfahrungen sind für die Kunstpädagogik nicht das Mittel zum Zweck der Kunsterfahrung. Ästhetischen Erfahrungen kommt ein hiervon unabhängiger Wert an sich zu. Aber Kunsterfahrung ist ohne zuvor erfolgte ästhetische Erfahrungen im Alltag nicht möglich. »Die Erfahrung der Kunst zehrt von der Erfahrung außerhalb der Kunst – und hier gerade von ästhetischen Erfahrungen in den Räumen der Stadt und der Natur, in denen die Koordinaten der Weltgewandtheit und des Weltvertrauens durcheinander geraten« (Seel 2007, S. 66) (Zu den philosophischen Wurzeln der ästhetischen Erfahrungen und ihrem Verständnis heute vgl. Tatarkiewicz 2003, S. 448ff.; Küpper/Menke 2003). Unser Wahrnehmungsverhalten bildet sich mitgängig und muss deshalb im Kunstunterricht thematisiert und geschult werden. Ästhetische Erfahrungen und Empfindungen erleben zu können, ist ein Teil unserer »Grundausstattung«, so der Kunstpädagoge Gert Selle, sie werde von Künstlerinnen und Künstlern lediglich intensiver genutzt und sensibler entwickelt (Selle 1988, S. 30).
Читать дальше
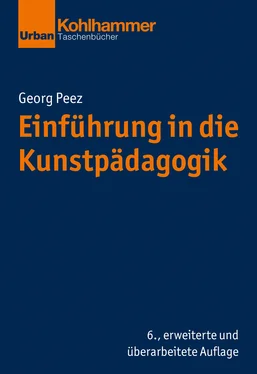
 Kap. 2.15) (Pazzini 2005). Aus Sicht der Praxis lässt sich die Wahl der Vermittlungsmethoden wohl vorwiegend als eklektisch oder noch treffender als pragmatisch bezeichnen. Das heißt, man wählt jeweils die situativ adäquat erscheinende Methode aus, die angesichts der eigenen Berufserfahrung momentan einen größtmöglichen Erfolg für kreative und produktive Anschlüsse verspricht. Die Wahl der Vermittlungsmethoden ist somit keinesfalls beliebig, d. h., zumindest im Nachhinein ist es mittels Reflexion möglich, die Wahl professionell zu begründen – unabhängig davon, ob sich die Wahl im Nachhinein auch als angemessen erwies. Es lässt sich offensichtlich der ›Kunstgriff‹ anwenden, dass Vermitteln auch angesichts der Anerkennung der Unvermittelbarkeit dessen, was Kunst ihrem Wesen nach ist, keineswegs überflüssig wird. Denn im Zentrum steht deswegen nun die Frage: Wie lässt sich die Nicht-Vermittelbarkeit der Kunst überzeugend und gegenstandsgerecht, d. h. kunstgerecht, vermitteln? Dass diese Frage so verhandelt wird, zeigt beispielsweise Hermann K. Ehmer mit seiner offenbar paradoxen Formulierung, wir müssten lernen, dass es an der Kunst nichts zu lernen gebe (Ehmer 1994, S. 14).
Kap. 2.15) (Pazzini 2005). Aus Sicht der Praxis lässt sich die Wahl der Vermittlungsmethoden wohl vorwiegend als eklektisch oder noch treffender als pragmatisch bezeichnen. Das heißt, man wählt jeweils die situativ adäquat erscheinende Methode aus, die angesichts der eigenen Berufserfahrung momentan einen größtmöglichen Erfolg für kreative und produktive Anschlüsse verspricht. Die Wahl der Vermittlungsmethoden ist somit keinesfalls beliebig, d. h., zumindest im Nachhinein ist es mittels Reflexion möglich, die Wahl professionell zu begründen – unabhängig davon, ob sich die Wahl im Nachhinein auch als angemessen erwies. Es lässt sich offensichtlich der ›Kunstgriff‹ anwenden, dass Vermitteln auch angesichts der Anerkennung der Unvermittelbarkeit dessen, was Kunst ihrem Wesen nach ist, keineswegs überflüssig wird. Denn im Zentrum steht deswegen nun die Frage: Wie lässt sich die Nicht-Vermittelbarkeit der Kunst überzeugend und gegenstandsgerecht, d. h. kunstgerecht, vermitteln? Dass diese Frage so verhandelt wird, zeigt beispielsweise Hermann K. Ehmer mit seiner offenbar paradoxen Formulierung, wir müssten lernen, dass es an der Kunst nichts zu lernen gebe (Ehmer 1994, S. 14).