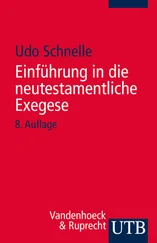Zweitens erweitern diese kurzzeitigen Skulpturen den Kunstbegriff (  Kap. 3.2), indem sie den Übergang vom Alltag zur Kunst ebnen. In diesem Kontext fördern sie auch die ästhetische Bildung. Wer einmal einen Pullover nach den Anweisungen von Wurm gefaltet und aufgehängt hat oder wer einmal eine »One Minute Sculpture« selbst ausgeführt hat, wird ab dann im alltäglichen Umgang jenes Kleidungsstück anders betrachten, falten oder anziehen. Er oder sie wird – wenn auch nicht immer, aber immer öfter – Gegenstände auf ihre Möglichkeit, Skulptur zu werden, überprüfen. Er oder sie wird eine Verbindung zwischen Kunst und Alltag herstellen und sich an die einmal selbst ausgeführte Aktion erinnern. Denn man hat einen innovativen skulpturalen Prozess selber mimetisch (d. h. kreativ nachahmend) erfahren (Lehmann 2003, S. 70f.).
Kap. 3.2), indem sie den Übergang vom Alltag zur Kunst ebnen. In diesem Kontext fördern sie auch die ästhetische Bildung. Wer einmal einen Pullover nach den Anweisungen von Wurm gefaltet und aufgehängt hat oder wer einmal eine »One Minute Sculpture« selbst ausgeführt hat, wird ab dann im alltäglichen Umgang jenes Kleidungsstück anders betrachten, falten oder anziehen. Er oder sie wird – wenn auch nicht immer, aber immer öfter – Gegenstände auf ihre Möglichkeit, Skulptur zu werden, überprüfen. Er oder sie wird eine Verbindung zwischen Kunst und Alltag herstellen und sich an die einmal selbst ausgeführte Aktion erinnern. Denn man hat einen innovativen skulpturalen Prozess selber mimetisch (d. h. kreativ nachahmend) erfahren (Lehmann 2003, S. 70f.).
Die Vermittlung seiner Kunst geschieht durch den Künstler und seine Handlungsanweisungen unmittelbar: In der tatsächlichen Aktion kann jeder versuchen, wie Franz Beckenbauer mit zwei Orangen eine Skulptur auf Zeit zu werden. Zweifellos liegt es in der Absicht des Künstlers, ästhetische Erfahrungen auszulösen. Die in Kapitel 1.3 aufgelisteten Strukturmomente ästhetischer Erfahrung kommen hier zum Tragen (  Kap. 1.3). Zum anderen lassen sich viele Werke mittelbar erfahren, indem man sich in den agierenden Menschen in Gedanken hineinversetzt: Welches Körpergefühl muss ich entwickeln? Welche Körperspannung, Konzentration und Balance muss ich halten? Welche Vorsicht muss ich walten lassen, damit die zwei Orangen nicht wegrutschen und ich selber nicht ins Wanken gerate?
Kap. 1.3). Zum anderen lassen sich viele Werke mittelbar erfahren, indem man sich in den agierenden Menschen in Gedanken hineinversetzt: Welches Körpergefühl muss ich entwickeln? Welche Körperspannung, Konzentration und Balance muss ich halten? Welche Vorsicht muss ich walten lassen, damit die zwei Orangen nicht wegrutschen und ich selber nicht ins Wanken gerate?
»Ein Kommunikationsraum« von Christine und Irene Hohenbüchler in Zusammenarbeit mit der Kunstwerkstatt Lienz
Auf den Böden eines weißen, etwa 1,70 m hohen Regals lagen viele Objekte, denen man bereits von Weitem ansah, dass sie mit etwas handwerklichem Ungeschick hergestellt worden waren: kleine figürliche Darstellungen von Phantasietieren aus Keramik; eine selbstgehäkelte Mütze; mehrere etwa handgroße, meist bunt glasierte Keramikschalen und -gefäße; einige mit Ornamenten grell bemalte Frottee-Handtücher; das Porträtfoto einer lachenden Frau, welches nachträglich durch Wachsmalkreide mit Mustern bunt verziert und auf ein Stück Pappe aufgeklebt war.
Dies alles war im Sommer 1997 in einem großen, hellen Raum der documenta X zu sehen, dem »Museum der hundert Tage« für zeitgenössische Kunst in Kassel. Am Eingang dieses Raumes hing an der Wand ein kleines Schild: »multiple autorenschaft. Christine & Irene Hohenbüchler in Zusammenarbeit mit Kunstwerkstatt Lienz. Ein Kommunikationsraum. 1996–1997«. Weitere schriftliche Angaben zu den Ausstellungsobjekten wurden nicht gemacht.
Diese Objekte waren auf ungewöhnlichen Möbeln präsentiert (  Abb. 3): An der Rückwand eines halbrunden, mitten im Raum stehenden, mit Ausstellungsobjekten bestückten Regals befand sich eine Sitzbank. Eine andere Konstruktion sah aus wie ein hoher Stuhl mit einer viel zu kurzen Lehne bzw. wie ein niedriger Schreibsekretär. Diese Stellage wurde als Präsentationstisch für einen Ringbuchordner mit in Prospekthüllen eingelegten Zeichnungen genutzt. Zwei Besuchende standen an diesem »Tischchen« und blätterten im Ordner. Sie unterhielten sich hierbei. Auf einem anderen Tisch stand ein Computer, auf dessen Bildschirm Grafiken aufgerufen werden konnten: Darstellungen eines Feuerwehrautos, eines Lastwagens, eines Hauses, einer Landschaft. An einer Wand stand eine ca. 1,50 m hohe Konstruktion aus Drähten, an denen mit greller Farbe bemalte Badeanzüge, Badehosen, mehrere Schwimmreifen und eine große aufgeblasene Plastikente präsentiert wurden.
Abb. 3): An der Rückwand eines halbrunden, mitten im Raum stehenden, mit Ausstellungsobjekten bestückten Regals befand sich eine Sitzbank. Eine andere Konstruktion sah aus wie ein hoher Stuhl mit einer viel zu kurzen Lehne bzw. wie ein niedriger Schreibsekretär. Diese Stellage wurde als Präsentationstisch für einen Ringbuchordner mit in Prospekthüllen eingelegten Zeichnungen genutzt. Zwei Besuchende standen an diesem »Tischchen« und blätterten im Ordner. Sie unterhielten sich hierbei. Auf einem anderen Tisch stand ein Computer, auf dessen Bildschirm Grafiken aufgerufen werden konnten: Darstellungen eines Feuerwehrautos, eines Lastwagens, eines Hauses, einer Landschaft. An einer Wand stand eine ca. 1,50 m hohe Konstruktion aus Drähten, an denen mit greller Farbe bemalte Badeanzüge, Badehosen, mehrere Schwimmreifen und eine große aufgeblasene Plastikente präsentiert wurden.
Die Zwillingsschwestern Christine und Irene Hohenbüchler, 1964 in Wien geboren, arbeiten seit Jahren mit Menschen zusammen, die u. a. in Nervenheilanstalten oder in Gefängnissen untergebracht sind. Die auf der documenta X ausgestellten Werke wurden von ihnen gemeinsam mit 20 geistig Behinderten in einem Zeitraum von zwei Jahren in der »Kunstwerkstatt« der »Nervenheilanstalt Lienz«, Osttirol in Österreich, geschaffen. Durch diese projekt- und werkstattorientierte künstlerische Kooperation entstanden verschiedene Werke mittels unterschiedlichster Herstellungsverfahren und Materialien, die die Geschwister Hohenbüchler zum Gesamtwerk, dem »Kommunikationsraum«, zusammenfügten.

Abb. 3: Christine und Irene Hohenbüchler (*1964), multiple Autorenschaft: Ein Kommunikationsraum, verschiedene Materialien und Medien, 1996/97. Resultate kollektiver Arbeiten in der »Kunstwerkstatt Lienz« mit Bewohnerinnen und Bewohnern der Nervenheilanstalt Lienz, Osttirol, Österreich
Christine und Irene Hohenbüchler sind weder Kunstpädagoginnen noch Kunsttherapeutinnen, sie sind sowohl in ihrem Selbstverständnis als auch im kunsttheoretischen Kontext durch ihre Teilnahme an der documenta X anerkannte Künstlerinnen. Auf vergleichbare Weise wie die Geschwister Hohenbüchler arbeiten gegenwärtig eine Anzahl zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler prozesshaft direkt in pädagogischen Zusammenhängen. In der Kunsttheorie wird gar gemutmaßt, dass sich langfristig künstlerisches Tun von der Bereitstellung ästhetischer Produkte zum Angebot ästhetischer Tätigkeiten für Menschen, die im weitesten Sinne etwas gestalten wollen, verschieben könnte. Diesen Kunstschaffenden ist ein zentraler Aspekt künstlerischen Arbeitens gemeinsam: Sie integrieren kunstpädagogische Handlungsweisen in ihre Kunstäußerungen und erweitern den Kunstbegriff hierdurch. Sie bearbeiten die Grenze zwischen Pädagogik und Kunst. Gerade durch die von ihnen ausgelöste Irritation an der Grenze zum pädagogischen System erfahren die Geschwister Hohenbüchler Aufmerksamkeit und Akzeptanz im Kunstsystem.
1.2 Kunstvermittlung – der ›blinde Fleck‹ der Kunstpädagogik
Hinsichtlich des komplexen und facettenreichen Beziehungsgefüges zwischen Pädagogik und Kunst wird ein Charakteristikum häufig genannt, welches eher die Unvereinbarkeit zwischen Kunst und Pädagogik betont: Die Möglichkeit einer Vermittlung von Kunst, einer Vermittlung dessen, was die Kunst zur Kunst macht, wird in der kunstpädagogischen Diskussion oft grundsätzlich angezweifelt (  Kap. 2.13und
Kap. 2.13und  Kap. 4.3). Dieser Zweifel betrifft den kunstpädagogischen Berufsstand fundamental, der zwischen Pädagogik und Kunst steht, dessen Aufgabe es ist, Kunst zu vermitteln. Freilich lassen sich bildnerische Techniken lehren und vermitteln, wie etwa das Schraffieren mit dem Bleistift oder der Umgang mit einem Bildbearbeitungsprogramm, aber wer das Spezifische von Kunst vermitteln will, macht sie sich gefügig. Er unterrichtet hierdurch an der Kunst vorbei. Die Entwicklung der modernen und zeitgenössischen heterogenen Kunstrichtungen macht nämlich deutlich, dass sich Kunst und Kunsterfahrung durch die Verweigerung gegenüber Verstehensabsichten und durch die Irritation der Rezipientinnen und Rezipienten stetig dem rational auslegenden Verstehen zu entwinden versuchen (Sontag 1968). Eine solche Verweigerungshaltung mit lehrenden Methoden pädagogisch ›zähmen‹ zu wollen wäre kontraproduktiv. Kunst ist demnach nicht didaktisierbar (Buschkühle 2003, S. 32ff.).
Kap. 4.3). Dieser Zweifel betrifft den kunstpädagogischen Berufsstand fundamental, der zwischen Pädagogik und Kunst steht, dessen Aufgabe es ist, Kunst zu vermitteln. Freilich lassen sich bildnerische Techniken lehren und vermitteln, wie etwa das Schraffieren mit dem Bleistift oder der Umgang mit einem Bildbearbeitungsprogramm, aber wer das Spezifische von Kunst vermitteln will, macht sie sich gefügig. Er unterrichtet hierdurch an der Kunst vorbei. Die Entwicklung der modernen und zeitgenössischen heterogenen Kunstrichtungen macht nämlich deutlich, dass sich Kunst und Kunsterfahrung durch die Verweigerung gegenüber Verstehensabsichten und durch die Irritation der Rezipientinnen und Rezipienten stetig dem rational auslegenden Verstehen zu entwinden versuchen (Sontag 1968). Eine solche Verweigerungshaltung mit lehrenden Methoden pädagogisch ›zähmen‹ zu wollen wäre kontraproduktiv. Kunst ist demnach nicht didaktisierbar (Buschkühle 2003, S. 32ff.).
Читать дальше
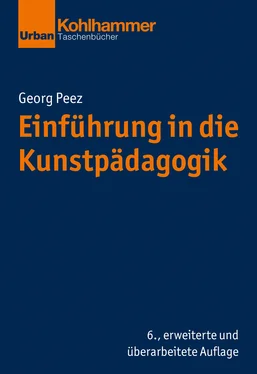
 Kap. 3.2), indem sie den Übergang vom Alltag zur Kunst ebnen. In diesem Kontext fördern sie auch die ästhetische Bildung. Wer einmal einen Pullover nach den Anweisungen von Wurm gefaltet und aufgehängt hat oder wer einmal eine »One Minute Sculpture« selbst ausgeführt hat, wird ab dann im alltäglichen Umgang jenes Kleidungsstück anders betrachten, falten oder anziehen. Er oder sie wird – wenn auch nicht immer, aber immer öfter – Gegenstände auf ihre Möglichkeit, Skulptur zu werden, überprüfen. Er oder sie wird eine Verbindung zwischen Kunst und Alltag herstellen und sich an die einmal selbst ausgeführte Aktion erinnern. Denn man hat einen innovativen skulpturalen Prozess selber mimetisch (d. h. kreativ nachahmend) erfahren (Lehmann 2003, S. 70f.).
Kap. 3.2), indem sie den Übergang vom Alltag zur Kunst ebnen. In diesem Kontext fördern sie auch die ästhetische Bildung. Wer einmal einen Pullover nach den Anweisungen von Wurm gefaltet und aufgehängt hat oder wer einmal eine »One Minute Sculpture« selbst ausgeführt hat, wird ab dann im alltäglichen Umgang jenes Kleidungsstück anders betrachten, falten oder anziehen. Er oder sie wird – wenn auch nicht immer, aber immer öfter – Gegenstände auf ihre Möglichkeit, Skulptur zu werden, überprüfen. Er oder sie wird eine Verbindung zwischen Kunst und Alltag herstellen und sich an die einmal selbst ausgeführte Aktion erinnern. Denn man hat einen innovativen skulpturalen Prozess selber mimetisch (d. h. kreativ nachahmend) erfahren (Lehmann 2003, S. 70f.).