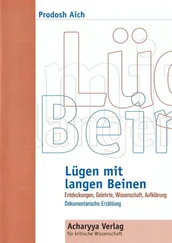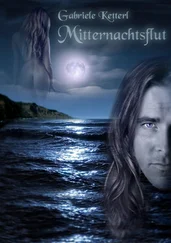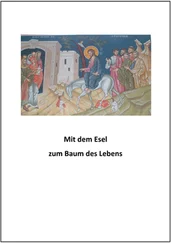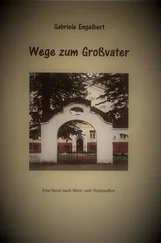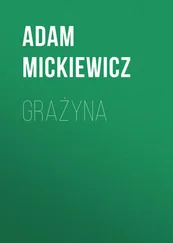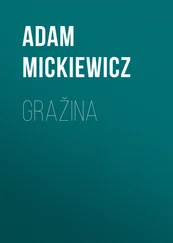Wurde Maxima Rosario zu Hause bei der Ernte gebraucht, fiel die Schule aus. Sie lernte, das kleine Lehmhaus in Ordnung zu halten und zu reparieren. Das Haus hatte ihr Vater mit Nachbarn erbaut. Zuerst hatten sie in dem Lehmboden ein Loch gegraben. Lehm, Wasser und klein gehäckseltem Stroh wurden mit den nackten Füßen gestampft, ehe aus dieser Masse dann Ziegel geformt wurden, die in der Sonne trockneten. Daraus wurde dann das Haus gebaut.
Sie lernte auf einem Tier zu reiten, Wasser zu holen und an der Wasserstelle die Wäsche zu waschen, die auf der Wiese oder an Sträuchern zum Trocknen ausgelegt wird. Brennholz sammeln, Maissuppe kochen oder die dünnen Maisfladen zu backen, gehören zur Hausarbeit. Die kleine Kochstelle liegt genau neben der Tür, so kann der Rauch bequem abziehen.
Auch der kleine Lehmstall neben der Hütte muss sauber gemacht werden. Am Abend versammelt sich die ganze Familie vor dem Haus. Alle essen dasselbe und wenn es dunkel wird, schlüpfte Maxima Rosario zu ihren Geschwistern auf eine Matte oder ein Tierfell, das auf der Erde lag, und kuschelte sich unter eine gewebte Wolldecke.
Ihre Familie gehörte noch zur Urbevölkerung des Andenstaates mit seiner kolonialen Vergangenheit, aber auch seinem brutalen Terror, der alltäglichen Gewalt und der Korruption in Peru, der grenzenlosen Armut und einem von Arbeitslosigkeit gekennzeichneten Land.
Doch mit sieben Jahren änderte sich ihr Leben dramatisch. Sie wurde als „Chica“ zu einer Señora und einem Patron in die Millionenstadt Lima geschickt. Sie sah zum ersten Mal das schäumende Meer und rund um sich herum nichts als gelbbraune Wüste. Maxima Rosario wusste, dass viele Mädchen in diesem Alter eingetauscht oder verkauft werden, um bei reichen Leuten bei einer Señora zu waschen, zu putzen, zu kochen und auf die Kinder aufzupassen.
In den kommenden Jahren würde sie mehrmals ihre Arbeitsstelle wechseln.
Sie musste auch auf die Kinder des Patrons aufpassen. Von Sonnenaufgang bis oft kurz vor Mitternacht. Ein eigens Zimmer hatte sie nicht, sie schlief auf der Erde in einer Ecke der Wäschekammer.
Maxima Rosario fügte sich in ihr Schicksal, sie kannte es nicht anders. Wenn der Patron sie nicht benötigte, vermittelte er die Kleine an Bekannte weiter. Der geringe Lohn reichte nie. Sie wurde oft beschimpft und lebte von den Essensresten der Familie oder dem, was man ihr übrig ließ. Nur ihre Arbeitskraft war gefragt und die möglichst kostenlos. Eine Schwangerschaft würde sie den Arbeitsplatz kosten. Das konnte sich Maxima nicht leisten.
Heimlich hatte sie bereits einigen Kindern das Leben geschenkt. Sie lebte in einer der unzähligen Callampas, die sich wie ein Kranz um die Millionenstadt Lima schmiegen. Etwa fünf Millionen Menschen leben auf diesen Müllhalden, um Abfall aus dem Wohlstandsmüll zu sammeln, Büchsen, Papier, Flaschen, Metall, Bekleidung und Essensreste, um zu überleben. Ohne Strom, ohne fließendes Wasser, ohne Kanalisation, in einer Hütte aus Holz und Blechteilen zusammengezimmert mit Karton, Plastikfetzen, Strohmatten gegen den staubigen Wind abgedichtet. Gegen den Regen schützen Wellblechreste notdürftig ab.
Das, was sie als Wäscherin oder Hausmädchen verdiente, reichte nicht. Ihre Señora ahnte auch nicht, dass sie hochschwanger war. Ihre weiten Indioröcke verbargen ihren Zustand geschickt.
An diesem 26. Juni 1980 bat sie die Pachamama, die Mutter Erde, dass sie ihr Kind erst in der Nacht schicken möge, denn dann könnte sie am anderen Morgen wieder zur Arbeit gehen ohne dass irgendjemand von der Geburt ihres Kindes erfuhr, denn dies hätte unweigerlich eine Kündigung zur Folge gehabt. Und womit sollte sie dieses weitere Kind ernähren und am Leben erhalten?
Hier in der Callampa war das menschliche Leid, die Not, die Verzweiflung und Aussichtslosigkeit oft nicht mehr zu ertragen. Maxima Rosario lebte von der Hand in den Mund, von einem Moment zu anderen, von einem Tag zum nächsten Tag, immer in Sorge, den Arbeitsplatz zu verlieren. Sie lebte nur vom und im Augenblick, orientierte sich an der augenblicklichen, momentan realen Welt und versuchte, nicht an das aussichtslose Morgen zu denken.
Ihre Kinder halfen, das tägliche Überleben zu organisieren, sie versuchten sich als Schuhputzer, trugen auf ihrem Kinderrücken schwere Lasten vom Markt zu den Reichen nach Hause, wuschen für etwas Geld die Autos im quirlenden Straßenverkehr, sangen in den Bussen, bis sie rausgeschmissen wurden. Ohne diese Arbeitseinsätze ihrer Kinder wäre eine Existenzsicherung nicht möglich gewesen.
An diesem Tag durchforsteten ihre Kinder die Müllhalden der Stadt, um Abfall zu sammeln, den man dann verkaufen könnte. Ein Leben auf den stinkenden, schwelenden Müllbergen. Tausenden von Kindern in Lima ergeht es so.
In dieser Nacht war Maxima Rosario noch unterwegs, sie war auf dem Weg nach Hause. Sie dachte an ihre Kinder und an das, was sich nun vehement regend unter ihren weiten, bunten Indioröcken verbarg und bewegte. Hoffentlich würde das Kind in dieser Nacht zur Welt kommen.
Sie wusste, dass sie ihr Kind nicht auf dem Standesamt in Lima anmelden konnte, wie ihre anderen Kinder auch. Sie existierten amtlich nicht. Damit fielen auch keine Gebühren an und wenn eines der Kinder sterben würde, müsste man keine „Todesgebühren“ bezahlen.
„Was soll ich bloß mit diesem Kind tun? Ich kann mich und die anderen Kinder kaum ernähren?“, murmelte sie verzweifelt vor sich hin.
Eine Freundin, die auch als Empleada, als Hausmädchen bei den reichen „Gringos“, den Weißen arbeitete, hatte ihr zugeflüstert, sie solle im Armenhaus ihr Kind zur Welt bringen.
Automatisch bog sie in die staubbedeckte, nächtliche Straße am Rande der Stadt ein und stand unvermittelt vor dem Armenkrankenhaus.
Morgens um 4:15 Uhr schenkte sie einem kleinen Mädchen das Leben. Nach neun Monaten brachte sie ihr 3.210 Gramm schweres Kind zur Welt.
Einen Namen erhielt das kleine Bündel Mensch nicht, es würde sowieso nicht überleben. Maxima Rosario hatte kaum Muttermilch, weder ein Bett noch ein warmer Raum war vorhanden. Draußen zeigte das Thermometer am Nachmittag ganze acht Grad plus an. Limawinter.
Sie wusste, dass sie das Hospital nach der Entbindung innerhalb von vierundzwanzig Stunden verlassen musste. Im ersten Morgengrauen schlich sie sich vorzeitig heimlich davon und tauchte im Nebeldunst unter. Ohne ihr Kind.
Das machen viele Indiofrauen, die vom Hochland in die Stadt kommen, um hier den Lebenskampf zu bestehen.
Außerdem musste sie als Wäscherin früh am Morgen kurz nach Sonnenaufgang bei der Señora ihre Arbeit aufnehmen, wenn sie ihre Arbeitsstelle nicht aufs Spiel setzen wollte.
Das kleine, verlassene und namenlose Wesen wurde in feste Tücher gewickelt und in einen Raum getragen, in dem auf langen einfachen Holzpritschen viele Neugeborene lagen.
Lima am 27. Juni 1980 - Ein Kind erblickt das Licht der Welt
Am anderen Tag kehrte Maxima Rosario ins Hospital zurück, drückte das kleine Bündel Mensch zärtlich an sich und kehrte mit ihm zurück in ihre Elendshütte. Dort legte sie ihr Kind in einen kleinen braunen Pappkarton. Es ist ihr Kind. Sie hat es unter Schmerzen zur Welt gebracht. Sie liebt dieses Kind, so wie jede Mutter der Welt ihr Neugeborenes liebt.
Doch von Liebe allein kann das Baby nicht leben, das weiß sie ganz genau: Ohne Milch, liebevolle Pflege, ohne Kleidung, Wärme und Nahrung muss ihr Neugeborenes sterben. Sie hat diese entsetzliche Erfahrung schon einmal gemacht.
Lima am 30. Juni 1980 - Überlebenskampf
Tagsüber musste sie das Kind in der winzigen Hütte zurücklassen. Die Kleine wimmerte, weinte, schrie. Nach wenigen Tagen gab das Baby den Kampf um sein bisschen Leben auf. Es lag im Kot, ein Teefläschchen als Nahrung neben den winzig kleinen Händchen, die zu Fäusten geballt waren. Ab und zu sah eines der Geschwister nach ihm, doch sie waren damit beschäftigt, auf den stinkenden Abfallhalden mit Hacken und Stöcken oder den bloßen Händen Brauchbares herauszuholen.
Читать дальше